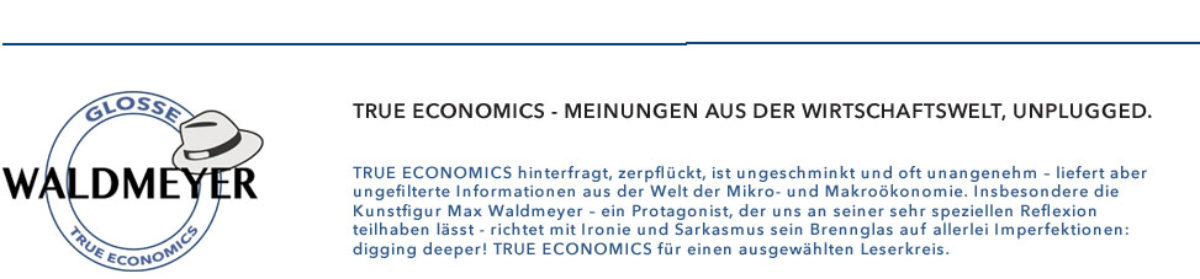Waldmeyer versuchte, wie so oft – und hier stellvertretend für den Bundesrat – über den Tellerrand hinauszublicken. Es gibt nämlich genügend positive Beispiele auf der Welt, wie man Krisen-Management in Sachen Corona effizienter betreiben könnte. Lassen wir mal das unverzeihlich autoritäre China auf der Seite. Aber hervorzuheben sind z.B. Taiwan, Südkorea, Singapur, Uruguay oder gar Vietnam: Frühzeitige konsequente Maskenpflicht, sofort funktionierende Warn-Apps, breit angelegte Tests und zielgerichtete (nicht politisch austarierte) Shutdowns führten zu wirtschaftlichen Kollateralschäden, die im Vergleich zu Europa quasi nur wie ein dünnes Rezessiönchen wirken. Offenbar erweist sich der helvetische Föderalismus als das Gegenteil von Schwarmintelligenz. Aber dazu später.
Auch Israel konnte rasche Erfolge verbuchen – zumindest während der vorbildlich gemanagten ersten Welle, aktuell aber auch mit den Impferfolgen. Selbst das südamerikanische Uruguay führt elegant durch die Krise.
Die Vereinigten Arabischen Emirate, um ein Beispiel etwas detaillierter herauszupicken, ebenso: Eine rigorose Maskenpflicht und strenge Desinfektionsmassnahmen führten zu raschen Erfolgen zu Beginn der Pandemie. Zu wenig Masken? Die Regierung verschickte sofort Schnittmuster, um aus Stoff eben kurzfristig selber Masken zu schneidern; Verstösse gegen die Maskentragpflicht wurden drakonisch bestraft (Busse: rund CHF 750.-). Und unverzüglich wurden grossflächig Drive-in-Testcenter angelegt, im ganzen Land. Überall und immer kann gratis getestet werden, sodass man die Kontaminierten blitzartig rauspflücken und in Quarantäne stecken kann. Eine Covid-Warn-App funktionierte schon im Frühjahr 2020, auch das Tracing. Und per heute sind gut 30% der Gesamtbevölkerung von rund zehn Millionen zum ersten Mal geimpft, ein zunehmender Teil davon bereits zum zweiten Mal. Insgesamt sind bis dato nur rund 800 Tote zu verzeichnen – verhältnismässig zwölfmal weniger als in der Schweiz.
Natürlich, die Bevölkerung ist z.T. wesentlich jünger in diesen Ländern, und in einem relativ autokratisch regierten Staat ist es einfacher, top-down und rasch zu handeln.Was Waldmeyer in der Privatwirtschaft gelernt hatte: Man überlebt nur mit frühzeitigem und raschem Reagieren. Das gilt indessen, leider, offenbar nicht für die Politik. Nicht einmal in einer Krise.

Wenn die wirtschaftlichen und persönlichen Freiheiten mittel- und langfristig geschützt werden sollen, braucht es kurzfristig rasche und zielgerichtete Massnahmen. Eben Management.
Mit dem vordergründigen Schutz von persönlichen Freiheiten wurde bei uns in der Schweiz – und in den meisten Orten in Europa – jetzt wohl Unfreiheit mit episch langen sozialen Einschränkungen eingetauscht: Wir erinnern uns an die frühen Diskussionen betreffend der Zumutbarkeit des Maskentragens, den Vorbehalten und Verzögerungen in Sachen Warn-App, der Schonung der Bevölkerung vor einem breit angelegten Testen. Und das übergrosse Verständnis für Impfgegner – in der falschen Interpretation, dass es nur um eigene Entscheidungsfreiheit geht und nicht auch um eine Frage der „Haftpflicht“ (aufgrund der flächendeckenden Übertragbarkeit einer Krankheit und damit eines Risikos). Das Resultat ist bekannt: ein Auf und Ab an Einschränkungsmassnahmen, irrlichternde Politiker, kein Plan.
Darf man, so fragte sich Waldmeyer, Demokratie und Föderalismus kurzfristig – für ein einzelnes Problem, wie Corona – reduzieren? Ja, man darf. Man muss sogar. Ein demokratisch sauber aufgestellter Staat darf es, weil die Bevölkerung das Vertrauen hat, dass nach einer Krisenbewältigung die alten Regeln wieder gelten.
Wie wäre es denn in einer Krise wie einer Strom-Mangellage? Was dürfte man da…? Einem verheerenden Terroranschlag? Einem Cyberkrieg, ausgelöst von Bösewichten oder einem verdeckt operierenden Staat? Dürfte man da auch? Man dürfte. Wieso denn nicht bei einer Pandemie, welche an unseren wirtschaftlichen Grundfesten rüttelt?
Nun bahnt sich das siebte Versagen an: „Long Covid“. Die Langzeitschäden der Krankheit können mindestens 10% der Erkrankten befallen. Damit schwebt das Damoklesschwert einer weiteren ökonomischen Belastung des Gesundheitswesens über uns. In einigen fortschrittlichen Ländern wurde das erkannt, und es werden Prophylaxen- und Medikamentenplanungen ausgearbeitet. Offenbar ist es allerdings auch hier der helvetischen Langsamkeit geboten, vorerst auf Beobachtung zu schalten. (Diese Langsamkeit ist üblicherweise sehr wohltuend, denn dann begeht die Politik weniger Fehler. Allerdings gilt das leider nicht in der Krise, denn hier ist rasches und kompetentes Management gefragt.)
Waldmeyer versuchte sich aus seinem ökonomischen Tagestraum zu lösen, seufzte und dachte an den Winzer Parmelin, die Konzertpianistin Sommaruga und den Schmalspur-Juristen Berset. Die Überforderung schien mit Händen zu greifen: Da sind überdurchschnittliche Führungsarmut, Organisationsversagen und ziemlich mangelhaftes Krisen-Management auszumachen, befeuert durch falsch verstandenen Föderalismus, mangelnde Visionen und die gänzliche Absenz von Mut. Oder glauben die Bundesverwalter eventuell allen Ernstes, dass man eine Pandemie – per se nun mal etwas ziemlich Internationales – auf kantonaler Ebene bekämpfen kann? Soll Appenzell Innerrhoden (16’000 Einwohner) also tatsächlich mit einem eigenen kantonalen Konzept dieses Pandemie-Fegefeuer bekämpfen?
Waldmeyer war trotz diesem eidgenössischen Staatsversagen zufrieden: Das Eingeständnis, dass das eigene Land im besten Fall nur Mittelmass bietet in der Causa Covid, zeugt auch von einer gewissen Grandezza. Die jüngste, gut abgestützte Untersuchung bringt es zutage: Platz 52 nur für Helvetien – von total 98 untersuchten Ländern. Man muss sich ja nicht mit Staaten messen wie Brasilien oder den USA, welche von irrlichternden Politikern gelenkt werden (und welche die allerletzten Plätze in dieser internationalen Rangliste belegen). Aber es ist immer erlaubt, sich an den besten Beispielen zu messen!
Ja, wir müssen auch mal zu unserem Versagen stehen. Diese Erkenntnis kann zudem durchaus befreiend wirken. Waldmeyer schenkte sich etwas kühles Bier nach. Er sass in einem Strandrestaurant in Dubai und blinzelte zum Meereshorizont. Genau, hierher sollte man mal den Berset in die Schule schicken. Aber vielleicht leidet dieser ja nicht an „Long Covid“, sondern an „Long Pipe Disease“: dieser heimtückischen, kaum kurierbaren Krankheit. Auf Deutsch nennt man sie wohl ganz einfach Langeleitung-Krankheit.