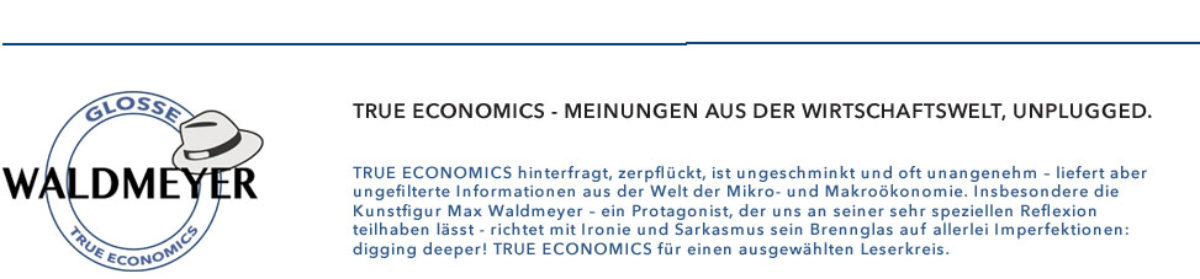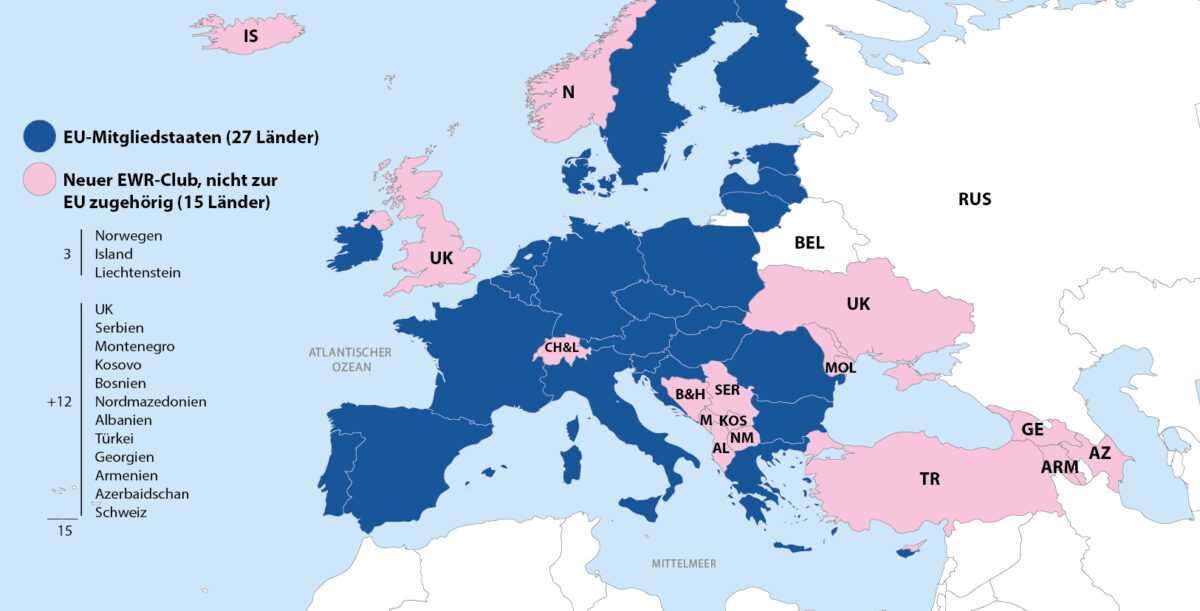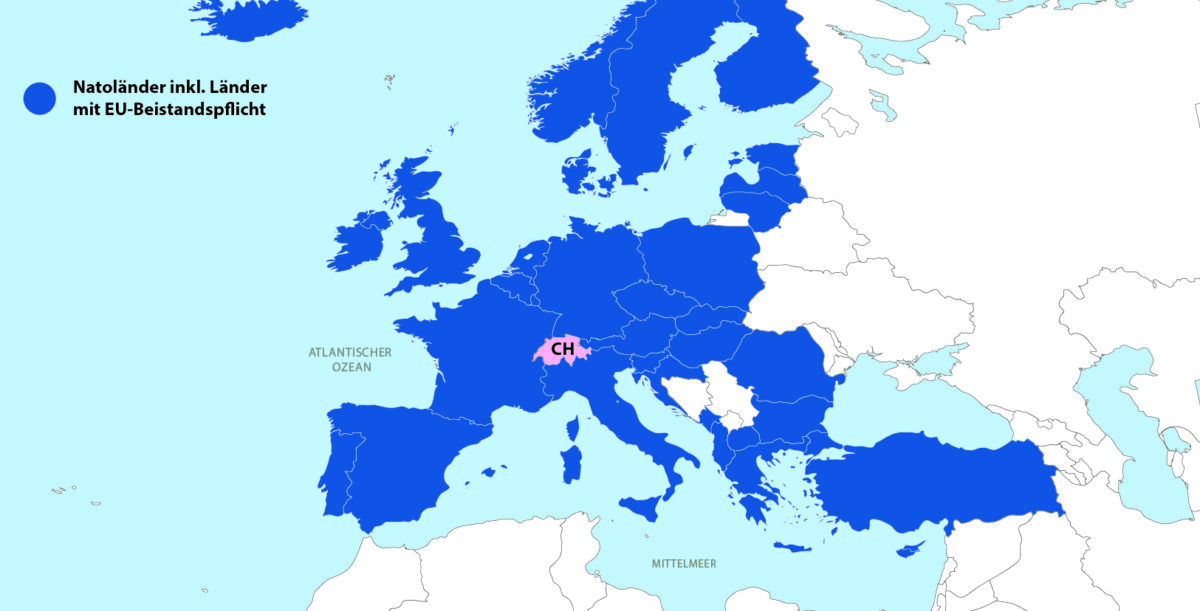Österreich hat nur unwesentlich mehr Einwohner als wir. Aber wir holen jährlich auf, und in ein paar Jahren werden wir das Land, bevölkerungsmässig, elegant hinter uns gelassen haben. Triumph wäre allerdings fehl am Platz, denn eigentlich bräuchten wir dringend viel mehr Österreicher!
Täglich sterben in der Schweiz etwas mehr, als neu geboren werden. Dieses Negativwachstum wird ökonomisch zum Fiasko, wenn die nichtarbeitende Bevölkerung immer älter wird. Also importieren wir Einwohner. Importe allein reichen indessen auch nicht, denn die Importe sollten sich selbstredend auch vermehren. Insbesondere Familien aus Exjugoslawien sind dabei wesentlich fertiler als andere, vor allem als ursprüngliche Schweizer. Die gebärfaulen Eidgenossen stellen nämlich bedeutend weniger Kinder auf die Welt; ohne die tüchtigen Immigranten würden wir vermutlich aussterben.
So werden wir immer mehr. Und immer wieder wird das Damoklesschwert einer 10-Millionen-Schweiz geschwungen, derweil gewisse populistische Kreise am liebsten die Grenzen schliessen würden. Dabei wird vergessen, dass die bevölkerungstreibenden Samenspender bereits unter uns sitzen, denn ein Grossteil der immigrierten Bevölkerung schätzt es, Grossfamilien zu begründen.
Kürzlich meinte unsere Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, dass sie auch nichts gegen eine 12-Millionen-Schweiz hätte. Das war natürlich eine sehr unbedachte Äusserung. Allerdings zog sie kaum Protest nach sich. Offenbar, leider, weil unsere ehemalige Sozialarbeiterin und Marxistin aus dem Jura einfach nicht ernst genommen wird?
Wann aber überholen wir Österreich?
In der Disziplin Skifahren ist uns das jetzt gelungen. Wenn sich in der Nacht beim Blick ins nahe Vorarlberg das Firmament rötet über unserem Nachbarland, so wissen wir, dass die Österreicher nun, aus Verzweiflung wohl, ihre Skier verbrennen.
In Sachen Bevölkerungszuwachs verlieren die Österreicher ebenso jedes Jahr: Die Schweiz legte letztes Jahr mit rekordverdächtigen 145’000 zu, im langjährigen Mittel sind es rund 80’000 Einheiten pro Jahr. Unsere Nachbarn bringen es langjährig nur auf rund 60’000. Wir stehen nun, anfangs 2024, bei knapp 9 Millionen Einwohnern, das einstige k. & k. Reich bei knapp 9.2 Millionen. Wir holen auf, jedes Jahr.
Waldmeyer hat es durchgerechnet: Genau am 11. September 2035 wird es so weit sein, dann haben wir die Österreicher überholt. Das Datum 9/11 hat sich aus purem Zufall ergeben, und es mag für unsere Nachbarn ein schlechtes Omen sein. Nicht aber für uns – was allerdings zu kurz gedacht ist. Doch alles der Reihe nach.
Die 10 Millionen kommen so oder so
2037 wird unser Land die 10-Millionen-Grenze knacken (die Österreicher schaffen es dann vermutlich 2039).
10 Millionen Einwohner: ob das schlimm sein wird? Zumindest Altbundesrat Blocher, ein grosser Warner vor diesem Bevölkerungsgau, wird es dann wohl kaum mehr stören. 10 Millionen müssen indessen gar nicht schlimm sein. Wenn es 2037 nämlich nicht 10 Millionen wären, sondern nur die heutigen 9 Millionen, dann hätten wir ein echtes Problem. Die Überalterung der Bevölkerung sähe dann nämlich noch dramatischer aus, denn der fehlende Nachwuchs und die fehlende Immigration mit relativ jungen Leuten würde unsere Demografie vollends in Schieflage bringen. Die jüngeren Konsumenten und Steuerzahler würden fehlen und könnten die älteste Generation nicht mehr finanzieren: mittels AHV-Beiträge, Steuern und Mehrwertsteuern. Firmen würden mangels Nachwuchses ausbluten und weniger zum Staatshaushalt beitragen. Ja, wir würden vielleicht verarmen. Oder wir müssten im zarten Alter von 90 vielleicht wieder einen Job suchen?
Absurde 10-Millionen-Grenze
Die sogenannte «Nachhaltigkeits-Initiative» der SVP kommt da gerade richtig. Wie stellt sich denn die Partei das vor, um Himmels Willen, wie man eine Bevölkerung von 10 Millionen einfach verhindern soll? Die Grenzen einfach dichtmachen? Kastrationen der zeugungsfähigen Bevölkerung? Deportationen? Remigration? Euthanasie?
Das allzu populistische Begehren ist schlichtweg nicht umsetzbar. Die Lage spitzt sich natürlich zu, denn die SVP sieht Handlungsbedarf, wenn die 10 Millionen vor 2050 erreicht werden. Waldmeyer rechnet aber bereits bei moderatem Wachstum mit 2037. Vielleicht kommt noch ein intelligenter Lösungsvorschlag aus einer SVP-Stammrunde. So zum Beispiel die Sperrung des Gotthards, eine allseits beliebte Idee.
Andere machen es nicht besser
Beruhigend ist, dass andere Länder ähnliche Probleme haben: Entweder wächst die Bevölkerung zu schnell oder zu langsam. Beginnt eine Regierung zu steuern, geht der Schuss meistens nach hinten los. So in China beispielsweise, wo die Ein-Kind-Politik, welche zu spät korrigiert wurde, nun zu einem Bevölkerungsrückgang führt. Die Chinesen sitzen dabei viel mehr in der Bredouille als andere Länder, denn sie bräuchten Millionen und Abermillionen von Immigranten jährlich. Die gibt’s gar nicht.
Frankreich wird in 20 oder 30 Jahren Deutschland als bevölkerungsreichste Nation Europas überholt haben. Während sich die Deutschen abschaffen, fördern die Franzosen das Bevölkerungswachstum mit Immigration und hohen Geburtenraten ihrer neuen Gäste (insbesondere aus dem Maghreb). Frankreichs Familienpolitik allerdings ist nicht ungeschickt, denn dank breit verankerter Kinderbetreuung produziert Frankreich immer noch anständige Geburtenraten, und la maman française pflegt in der Regel weiterzuarbeiten – weshalb Frankreich ein viel weniger gravierendes Problem in Sachen Facharbeitermangel hat.
Brüssel wird muslimisch
Apropos Immigration: Die Stadt Brüssel wird schätzungsweise irgendwann in den 2030er-Jahren zu über 50% muslimisch sein. Die jahrelange starke Immigration aus muslimischen Ländern trägt Früchte, denn muslimische Familien, wie wir auch in der Schweiz schon bemerkt haben, scheinen sich einer besonders hohen Fertilität zu erfreuen. Dies nicht aufgrund der staatlichen Kinderförderung, sondern offenbar der DNA-bedingten ethnischen Gebärfreudigkeit wegen.
Wen sollten wir denn bitte importieren…?
Aber zurück zu unseren eidgenössischen Problemen: Noch mehr Deutsche könnten wir kaum ins Land bitten – die Bevölkerung unseres nördlichen Nachbarn wird künftig wohl stark rückläufig sein. Ausserdem wird sich der Rest der germanischen Population um die Probleme ihres politischen und wirtschaftlichen Niedergangs kümmern müssen, der ziemlich zeitgleich mit der wirren Ampelregierung 2021 seinen Lauf nahm. Notfalls müssten wir also noch mehr Österreicher abwerben und sie in die Schweiz bitten. Sie würden dann noch ein bisschen mehr für uns arbeiten und gut Steuern bezahlen. Aber wir würden sie anständig bezahlen.
Dem Fluch des Bevölkerungswachstums ausgeliefert
Waldmeyer merkt: Wir sind dem Fluch des Bevölkerungswachstums ausgeliefert. Unsere fortschreitende Überalterung schreit geradezu nach einem Ausweg. Insgesamt vier Lösungen bieten sich an:
- Wir könnten weniger alt werden. Die Umsetzung dieses Ansatzes wird allerdings zu schwierig sein.
- Wir arbeiten länger, so bis 70 beispielsweise. Ein, zwei Jahre könnten wir vielleicht politisch noch rausholen, mehr aber wohl kaum. Die Gewerkschaften und andere linke Kreise würden eine weitergehende Erhöhung des Rentenalters zu verhindern wissen. Und die Generation Z würde das auch nicht lustig finden.
- Wir könnten unsere Immigranten bitten, noch etwas mehr Kinder zu gebären. Aber das würde vielleicht unseren helvetischen Groove im Land zu stark verändern. Waldmeyer möchte kein zweites Brüssel.
- Also müssten wir doch mehr Menschen ins Land reinlassen. Am liebsten Leute, die uns etwas ähnlich sind. Die nördlichen Nachbarn fallen, wie wir gesehen haben, künftig wohl weg, angesichts ihrer teutonischen Kernschmelze. Also verbleiben nur noch die Österreicher.
Wir kommen um die Österreicher nicht herum
Waldmeyers Konklusion nun: Die Bevölkerung anzuhalten, mehr Kinder zu kriegen, reicht nicht. Erstens hält sie sich kaum an solche Vorgaben, zweitens dauert es viel zu lange, bis diese neuen Bürger auch ordentlich Steuersubstrat abwerfen und AHV-Beiträge abdrücken können. Wir brauchen also junge, gescheite und gut ausgebildete Leute, die zu uns kommen und sofort rentieren.
Und wir sollten uns nicht länger lustig machen über die Österreicher, denn wir kommen um sie nicht herum. Vielleicht sollten wir sie im Skifahren auch wieder einmal gewinnen lassen. Und wir müssen zur Erkenntnis gelangen, dass wir sie, bevölkerungsmässig, gar nicht überholen sollten. Im Gegenteil. Wir können nur hoffen, dass sie sich künftig etwas stärker vermehren, so entsteht, aus österreichischer Sicht, wertvolles Exportgut. Oder eben wertvolles Importgut – aus unserer Sicht.