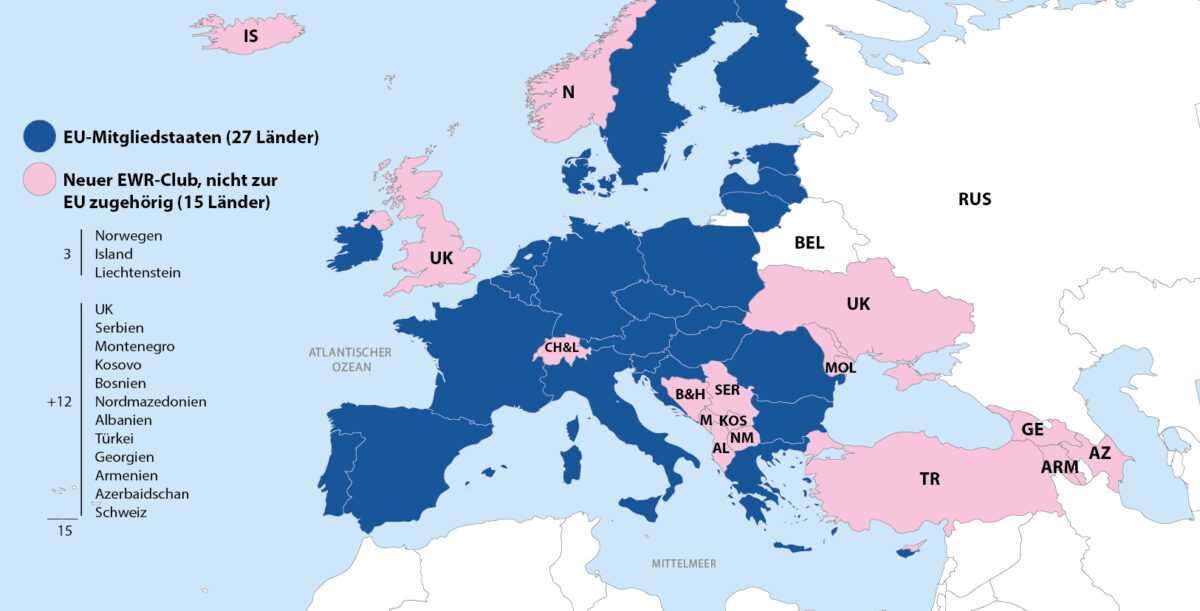Waldmeyer nahm sich vor, den ESC anzuschauen. Einfach so, aus Neugierde. Auch, weil er diesen Nemo nicht verstand. Aber es lohnte sich, denn nun kam er in den Genuss einer wichtigen Erkenntnis!
Um es gleich vorwegzunehmen: Mit Singen hatte der Event, in den Augen Waldmeyers, ziemlich wenig zu tun. Schon nach wenigen dieser obskuren Darbietungen schlief er deshalb ein.
Charlotte meinte: „Du hast die Finnen verpasst!“
Verblüffend schlechte Songs
Also schaute Waldmeyer die Finnen nach. Sein Fazit: Waldmeyer rät allen, die Finnen unbedingt anzuschauen! Der Leadsänger, der zudem gar nicht singen kann, ist nur mit einem dünnen T-Shirt bekleidet, ansonsten nackt – ja, füdliblutt. Am Ende der verwirrenden Show kommen an einem Seil die rettenden Shorts von der Bühnendecke runter. Halleluja.
Lettland verblüffte dagegen mit einem merkwürdigen Barden, Typ Yul Brynner, er trug einen glänzenden, königsblauen Neopren-Anzug mit Sixpack-Einlage. Und Irland präsentierte ein nicht-binäres Geisterwesen, Bambie, welches leider wirklich auch nicht singen konnte.
Israel kann singen
Der beste Beitrag, so Waldmeyers wie immer objektive Wahrnehmung, kam von dieser bezaubernden israelischen Sängerin. Sie konnte tatsächlich singen. Aber Israel wurde von allen Seiten boykottiert und drangsaliert. Unsere Greta Thunberg stand offenbar hinter verschiedenen Aktionen gegen Israel, auch einer gut organisierten Demo in Malmö. Dabei war es doch in den letzten Monaten wieder so angenehm ruhig geworden um Greta. Und nun dies… Ob die Palästinenser vielleicht die besseren Klimaschützer sind? Waldmeyer ist verwirrt.
Wir sehnen uns die Seventies zurück
Ziemlich peinlich präsentierte sich Grossbritannien: Eine offensichtlich gleichgeschlechtlich orientierte Männergang quälte sich, gutturale Urlaute ausstossend, in so was wie einer Gefängniszelle rum. Mit Bedauern erinnerte sich Waldmeyer an die grossartigen englischen Rock- und Popgrössen aus den Siebziger Jahren. Und nun dies – ein Jammer. Aber offenbar war diese Darbietung jetzt, 2024, das Beste, was UK liefern konnte?
Armenien überraschte mit einem hübschen Girl in einem (armenischen) Dirndl. Das lenkte zumindest von der Tatsache ab, dass auch dieser Song grottenschlecht war.
Kein einziger „Car Song“
Überhaupt, eigentlich waren fast alle Songs grottenschlecht. Waldmeyer würde keinen einzigen in seinem Auto hören. Zum Teil wäre dies sogar gefährlich, ja kaum zu verantworten: Der französische Beitrag beispielsweise war dermassen einschläfernd, dass man unweigerlich einen Unfall verursachen würde.
Nemo kann tatsächlich singen
In der Tat musste Waldmeyer anerkennen, dass dieser Nemo singen kann. Seine Gesangseinlagen mit den virtuosen Oktavenwechseln erinnerten Waldmeyer etwas an Rocky Horror Picture Show. Eigentlich war Waldmeyer ganz stolz auf die Schweiz. Number One! Und ja, dieser Kerl hat, zumindest gesangsmässig, eigentlich mitgeholfen, den ganzen Contest zu retten. Mit Schaudern erinnerte sich Waldmeyer an die unsägliche Gunvor Guggisberg – es war 1998: «Switzerland, zero points!»
Aber Nemo wird heute ja kaum wegen seinem Song gehypt. Das Nonbinäre kommt wohl stärker rüber. Ohne die rosa Strumpfhosen, ohne nonbinär zu sein und ohne diesen lustigen schwenkbaren Tanztisch mit den einigermassen gelungenen akrobatischen Einlagen wäre Nemo vielleicht bedeutungslos geblieben. Auch wenn er tatsächlich singen kann.
Es geht gar nicht ums Singen
Waldmeyer erkannte: Es geht also gar nicht ums Singen. Sondern um den Gesamteffekt. Und je heterosexueller, desto weniger erfolgreich. Nemo hat sogar einen besonderen Wettbewerbsvorteil, weil er sich nicht nur als nonbinär bezeichnet, sondern auch als „pansexuell“. Waldmeyer war neugierig und googelte. Pansexuelle sind nicht einfach kommune Bisexuelle, sondern öffnen ihr Spektrum und schliessen sämtliche sexuellen Ausprägungsformen ein – also auch alle feinen Zwischenformen, die man sich ausdenken darf.
Vielleicht gilt das nun generell in unserer Gesellschaft? Zumindest, dass Nonbinärsein in der Aussenwahrnehmung als etwas durchaus Erstrebenswertes gilt?
Waldmeyer startet eine Umfrage
Waldmeyer fragte seine Kinder, beide Anfang zwanzig, ob sie den ESC verfolgt hätten. „Spinnst du, Dad?“, meinten Noa und Lara wie aus der Pistole geschossen. Aber beide kennen Nemo, klar, und sie finden ihn ganz cool.
Waldmeyer fragte nun in seinem Bekanntenkreis nach. Aber niemand hatte den ESC richtig verfolgt. Bis auf die Mitschnitte in der Tagesschau, die hatte man mitbekommen. Waldmeyer empfahl allen, die er fragte, den Finnenbeitrag noch nachzuschauen.
Wo steckt die Zielgruppe?
Was nun unklar blieb: Wo versteckt sich denn die Zielgruppe für alle diese zum Teil seltsamen „Songs“? Waldmeyer fragte in seiner Nachbarschaft nach, so bei Freddy Honegger. Ohne Erfolg. Reto Sonderegger, sein Schwager, hatte beim ESC gleich weggezappt, sein Cousin Bruno Spirig (untergetaucht, wie wir wissen, auf der kanarischen Mini-Insel El Hierro) hatte, mangels TV-Programmen auf dem Eiland, nur die Spanier gesehen, offenbar mit einer ziemlich peinlichen Performance. Nemo hatte er verpasst („Nemo der Fisch?“).
Nonbinär kommt einfach gut an
Waldmeyer war ratlos. Jemand hatte offenbar die ganze Zielgruppe gestohlen. Versteckte sie sich vielleicht hinter der Kassiererin im Volg oder dem Filialleiter des Baumarktes in Villmergen? Waldmeyer hatte auch die Poststellenleiterin in Wohlen (die mit dem Nasenring) in Verdacht. Auch Gaberthuler, Waldmeyers nerviger Steuerkommissär in Meisterschwanden, könnte ebenso gut ins ESC-Publikum passen. Ja, es muss sie eben doch geben, diese Zielgruppe. Vielleicht unbemerkt – oder gar heimlich!
Wie dem auch sei, nonbinär kommt zumindest gut an, soweit Waldmeyers ESC-Konklusion. Waldmeyer hat überhaupt nichts dagegen, wenn einer einen Rock tragen möchte. Und wenn sich jemand nonbinär fühlt, geht das selbstredend auch in Ordnung. Jeder soll eben machen und denken, was ihm beliebt – solange unser Gesellschaftssystem nicht wirklich gestört wird.
Waldmeyer versteht den Hype nicht
Aber Waldmeyer versteht diesen Hype einfach nicht, der um das ganze Thema gemacht wird. Zudem erscheint es seltsam, dass einem zusehends Skepsis entgegenschwappt, wenn man keine Regebogenflagge schwenkt. Merkwürdig ist auch, dass Nonbinärsein in der neuen Welt offenbar einen höheren Anerkennungswert hat als profanes Binärsein.
Vielleicht wäre es also einen Test wert, etwas nonbinär zu spielen und damit in der sozialen Wahrnehmung aufzusteigen?
Waldmeyer könnte, nur beispielsweise, einen Tanz- und Gesangskurs belegen. Nur schon die Absicht allein würde ihm vielleicht viele Credits einbringen.
Waldmeyer zieht es durch
Wie so oft, beliess es Waldmeyer allerdings nicht beim Konjunktiv. Er fuhr kurz entschlossen nach Zürich, zu diesem Kurs. Und als er, zurück von dem Lehrgang, seinen Porsche Cayenne (schwarz, innen auch), wieder vor seiner Garage parkte und mit einem eleganten Hüpfer das Cockpit verlassen wollte, verfing sich sein Rüschenrock an der Türschwelle. Leider schaute gerade Freddy Honegger über den Zaun. „Ich kann dir alles erklären, Freddy“, kam Waldmeyer dem entgeistert blickenden Honegger zuvor und verschwand mit seinen pinkfarbenen Strumpfhosen blitzartig im Haus.
Dort blickte ihm Noa bereits anerkennend entgegen: „Der Glitter im Gesicht steht dir super, Dad!“
Waldmeyer atmete erleichtert auf. Es schien zu funktionieren: Zumindest bei der jungen Generation schien sein neuer Look gut anzukommen!