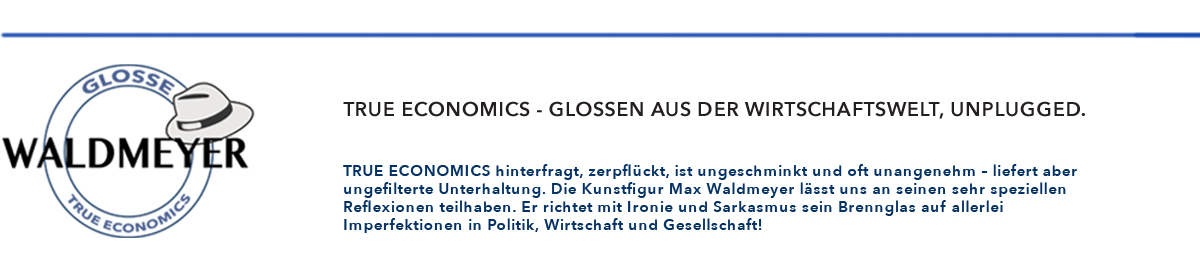Oder: Das künftige Leben im „Gutstaat“
Die westliche Welt wird künftig anders aussehen – in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Sie wird besser werden, stressfreier. Und viel sozialer, auch inklusiver. Waldmeyer malt sich ein Bild, wie die nahe Zukunft aussehen könnte.
Waldmeyer findet es nicht schwer, sich eine Welt vorzustellen, welche alle positiven ökonomischen und sozialen Errungenschaften vereint. Eine bessere Welt einfach, vielleicht so in zehn Jahren erst – eine gewisse Transformationszeit muss man einer Gesellschaft ja zugestehen.
Waldmeyer blickt zurück auf das Jahr 2024
Rückblickend stellt Waldmeyer fest, dass die ersten Schritte 2024 erfolgten. Wenn man jeden Schweizer Bürger gefragt hätte, ob er im Lotto gewinnen möchte, hätte er Ja gesagt. Die Frage damals lautete ähnlich: Möchtest du nicht eine 13. AHV erhalten? Mit deutlichem Mehr hatte das Volk damals, seiner Logik folgend, mit einem Ja geantwortet und sich nicht auch noch um die Finanzierung der Ausgaben gekümmert. Dafür ist schliesslich der Staat zuständig. Und so könnte sich die Gesellschaft in den Folgejahren weiter verändert haben. Dabei musste vorab das eigene Glück im Vordergrund stehen. Es ging bei dieser Transformation um viel mehr als eine gute Work-Life-Balance. Es ging um einen Umbruch.
Man wird sich künftig um naheliegende Themen kümmern
Wir werden uns künftig viel weniger um politische Themen gekümmert haben. Vor allem nicht um solche, die weit weg von uns liegen – z.B. in der Ukraine. Die Russen machen eh, was sie wollen. Was sollen wir uns in der Schweiz um etwas kümmern, das wir gar nicht beeinflussen können! Wenn sie kommen, dann kommen sie. Unsere Armee könnte ohnehin nichts ausrichten. Die der Deutschen erst recht nicht, die ist noch weniger einsatzfähig. Und die Franzosen sahen kürzlich ein, dass sie mit ihren Geräten und der Munition gerade einmal 80 Kilometer Grenze – und dies nur während ein paar Tagen – verteidigen könnten.
Endlich wird die Gesellschaft inklusiver
Also kümmern wir uns richtigerweise um Themen, die etwas näher liegen: Um die Pflege der Diversitäten in der Gesellschaft, beispielsweise. Wir pflegen auch eine diverse Sprache, mit «Innen» und Doppelpunkten und vielem mehr. Jeder darf, wie er will.
Selbstzweifel? Das Rezept: Durch mehr Zuwanderung kann man sich positiv verändern. Deshalb auch die neuen Ramadan-Beleuchtungen, die in Deutschland und Frankreich in den Städten errichtet werden. Das ist dann nicht kulturelle Aneignung, sondern einfach inklusive, umsichtige Denke. Ja, man muss sich gutstellen mit den Bürgern und Einwohnern anderer Kulturen. Deshalb hatte Deutschland der Ukraine nach dem russischen Einmarsch erst mal ein paar Helme versprochen. Mit weitergehender Hilfe wollte man es sich mit Putin nicht verscherzen. So sieht professionelle Umsicht und Weitsicht aus.
Die Schweizer Jusos machen es vor
Die Jusos sind noch mutiger. In einem Positionspapier forderten sie bereits 2024 einen kompletten Umbruch von Wirtschaft und Gesellschaft: die Vergemeinschaftung von Vermögen, die Konzentration auf ein inklusives Leben, die Einführung der 24-Stunden-Woche. Das war konsequent. Malochen bringt einen nicht wirklich weiter. Der mutige Juso-Entwurf ist damit eine innovative Weiterentwicklung ur-kommunistischen Gedankengutes, Karl Marx’ einfach gestrickte Ideen erhalten so eine ganz andere Qualität. Die neue Erbschaftsinitiative der irrlichternden Partei spricht Bände.
Über allem stehen die Klimaziele
Die neue aufgeklärte Gesellschaft verfolgt ein Netto-Null-Ziel in Sachen CO2, bis 2050 soll es erreicht sein. Dabei kümmert man sich nicht um die grossen Umweltbelastungen im grossen Rest der Welt; Mikro-Management wird bevorzugt. Nun, man muss eben auch mal den Schneid haben, mit gutem Beispiel voranzugehen!
So fühlen wir uns leichtherzig mit jeder Fahrt im ÖV, und jede Aufhebung eines Parkfeldes und mit jeder neuen 30er-Zone in einer Hauptstrasse verbessert sich das Empfinden in der Gesellschaft. Der Einbau einer Wärmepumpenheizung verschlingt zwar Unmengen an Strom, den es künftig gar nicht zur Genüge geben wird. Aber diese Entscheide, einer Übersprunghandlung gleich, geben uns ein gutes Gefühl. Auch der Betrieb eines Elektrofahrzeuges erfüllt uns mit Stolz, denn wir schaffen es, gleichzeitig auszublenden, dass dieses zum Teil mit schmutzigem Strom aus dem Ausland fährt. Waldmeyer versucht seit Jahren, seiner Nachbarin Bettina Honegger (Verschwörungstheoretikerin, Impfgegnerin, gegen 5G, fährt einen weissen Elektro-Golf) zu erklären, dass ihr Gefährt eigentlich eine Dreckschleuder ist, betrieben, unter anderem, mit importiertem Kohlestrom aus Polen und Deutschland. Aber die Kunst Bettinas – und vieler anderer – besteht gerade darin, Waldmeyers Kritik komplett auszublenden. Und Waldmeyers Schwester Claudia (frühpensionierte Primarlehrerin, Kurzhaarschnitt, lustige farbige Brille) hockt den ganzen Tag vor ihrem PC und spielt mit Chat-GTP, welches gigantische Mengen an Strom benötigt, setzt sich aber politisch für strenge Energieziele ein.
Die Verkehrswende
Waldmeyer versuchte weiter, zehn Jahre positiv vorauszudenken. Er würde sich dann konsequenterweise nicht daran stören, künftig mit dem Velo oder dem Lastenrad in den Städten rumzukurven. So geläutert, würde er endlich die Ruhe und die gesunde Luft geniessen können. Die Abschaffung der individuellen Verkehrsmittel gegen Mitte der 2030er Jahre war schliesslich überfällig gewesen. Überland würden dann nur noch elektrisch betriebene Uber- und Bolt-Fahrzeuge unterwegs sein, mit jungen und gutaussehenden Fahrerinnen und Fahrern, die ihre Arbeit freiwillig verrichten. Es werden allerdings nur ganz kleine Fahrzeuge sein, denn der Strom ist knapp im Land. In der Nacht wird die Fahrt auf fünf Kilometer pro Fahrt beschränkt werden, denn dann, das hatte man herausgefunden, produzieren die Sonnenkollektoren nichts. Das ist aber egal, denn zuhause ist es auch schön. Im Winter gelten die gleichen Regeln, aber dann ist ohnehin 90% Homeoffice für alle angesagt, man muss also gar nicht raus. Im November werden sich die meisten Mitarbeiter der Firmen eh schon zur «Workation» abgemeldet haben, sie arbeiten dann von Thailand oder von Bali aus. Sie kommen später im Februar glücklicher und reich an Lebenserfahrung zurück an den Arbeitsort und haben viel zu erzählen. Das befruchtet nicht nur das Arbeitsklima, sondern auch die Firmen zehren dann von diesen wertvollen neuen Erfahrungsschätzen.
Das bedingungslose Grundeinkommen wird Realität
Die Summe aller Sozialleistungen für Bedürftige wird ein Level erreichen, welches einem bedingungslosen Grundeinkommen entspricht. Der Staat nimmt, der Staat gibt. Aber er tut dies als verantwortungsvoller Geber. Wäre der Staat ein Mensch, wäre er ein Gutmensch. Damit wird der Begriff des «Gutstaates» neu definiert. Der Gutstaat garantiert nicht nur ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern auch ein bedingungsloses Vermögen, die Idee wurde kurzerhand von intelligenten Vorstössen in Deutschland abgekupfert.
Fortschrittlichere Arbeitsmodelle
Die Optimierung der Work-Life-Balance wird neu nicht mehr im Mittelpunkt der Arbeitnehmer stehen, sondern endlich auch die Arbeitgeber erreicht haben. Die Firmen werden erkannt haben, dass Arbeiten allein die Arbeitnehmer nicht glücklich macht. So wird jeder so viel arbeiten können, wie er möchte – selbstredend auch von zuhause aus. Die Firmen selbst haben inzwischen ihre Ziele geändert: Es geht jetzt nicht mehr darum, Gewinne zu erwirtschaften, sondern darum, a) Klimaziele zu erreichen, b) möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen, c) um Arbeitnehmer glücklich zu machen und d) sich nötigenfalls abzuschaffen, wenn diese Ziele nicht erreicht werden können. Glücklicherweise wird es einen «Staats-Coach» geben, der die Firmen beim Erreichen dieser Ziele begleitet und der die diversen sozialen Auffangbecken bereithält, wenn etwas aus dem Ruder läuft.
Das Erbe gehört dem Staat
Zu Beginn dieses gesellschaftlichen Umbruchs hatte man sich allenthalben Sorgen gemacht, dass diese soziale Weiterentwicklung nicht finanziert werden kann. Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen, und die Nachkommen brauchen die Kohle auch nicht, denn der Staat sorgt für sie. Also soll das Erbe dem Staat gehören – nicht zu 50% für grosse Vermögen, wie eine Juso-Initiative im Jahr 2024 wenig mutig vorsah, sondern zu 100%. Ein geniales Konzept, denn so kommt laufend unheimlich viel Geld in die Staatskasse. Grosszügig bezahlte Staatsangestellte können das Geld anschliessend wieder grosszügig verteilen, vielleicht vom Homeoffice aus und auf der Basis einer 24-Stunden-Woche.
Den Anfang machte tatsächlich die Juso-Initiative, welche 2026 vom Volk überraschenderweise, entgegen allen Prognosen, doch noch angenommen wurde; ab dann wurde eine staatliche Erbschaftssteuer von 50% auf hohen Vermögen erhoben. Sie brachte zwar kaum etwas ein, da sich die grossen Erblasser schon früher aus dem Staub gemacht hatten. Aber das Signal war wichtig: Die Bürger hatten erkannt, dass Erbschaften eigentlich dem Staat gehören.
Endlich weniger Leistungsdruck
Ja, vieles wird sich in den nächsten Jahren zum Guten verändert haben. Nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch davor, in der Schule, wo endlich der Leistungsdruck zurückgenommen wurde.
Bis zur Matura werden neu keine Noten mehr vergeben. Die Forderung von gewissen Kreisen, nun konsequent eine 20-Stunden-Woche für Arbeitseinsteiger einzuführen, wird auf grosses Interesse gestossen haben. Ein Drittel der urbanen Jugendlichen hatte bereits 2024 Depressionen, einige Jahre später waren sie erst recht überfordert. Völlig unverantwortlich wäre es deshalb, sie in den Armeedienst zu schicken. Überhaupt, die Armee sollte Frieden verbreiten. Eine SP-Vertreterin stellte fest (es war ebenso 2024), dass die Armee eigentlich keine Bewaffnung braucht. Auch Drohnen sollten nicht bewaffnet werden, so die gleiche Politikerin in der Aussenpolitischen Kommission.
Der Westen irrlichtert
Waldmeyer war zufrieden mit seiner weitsichtigen Vision für eine heile Welt. Der vermeintliche Weg zum Glück besteht also darin, dass wir gute Handlungen vornehmen und gleichzeitig die Absurditäten dahinter verdrängen. Das leuchtet ein. Wir nennen es dann Fortschritt und wähnen uns auf einem höheren Zivilisationsniveau.
Diese perfekte Welt wurde schon viel angedacht, von Karl Marx bis zu linken und grünen Weltverbesserern in Politik und Gesellschaft. Weder Karl Marx noch die Kibbuz-Erfinder noch die neuen Protagonisten einer besseren und glücklicheren Gesellschaft sind schlechte Menschen. Aber sie lagen und liegen einfach falsch.
Waldmeyer versteht seine wirre Vision nur als Mahnung. Er will lediglich aufzeigen, in welche zum Teil absurde und ökonomisch suizidale Richtung sich unsere westliche Gesellschaft bewegt. Der Rest der Welt wird indessen Freude an unserer Entwicklung haben, denn so werden wir noch schneller überholt werden. Insbesondere erfolgreiche Staaten in Asien klopfen sich auf die Schenkel. Wie sagte doch Waldmeyer schon zu seinem Sohn Noa: «Du wirst sehen, die Asiaten werden dereinst unsere Villen bewohnen und du wirst sie putzen müssen!»