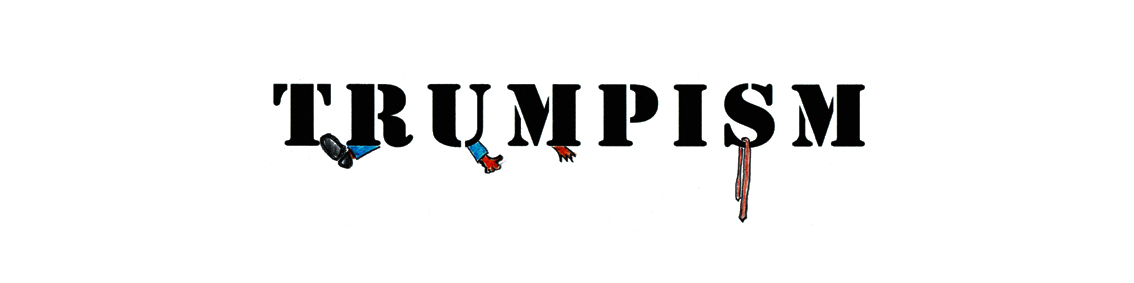Der Spuk ist vorbei. Wir können aufatmen. Alles erscheint plötzlich besser als Trump – so sehen es zumindest der überwiegende Teil der westlichen Bevölkerung und deren Staatschefs. Dabei tritt völlig in den Hintergrund, wie die Alternative aussehen sollte. Das ist inzwischen allerdings ziemlich egal. Hauptsache, der irre Hasardeur mit den orangen Haaren ist weg. Zeit für eine objektive kleine Analyse also: Was hat uns der „Trumpismus“ gebracht? War wirklich alles falsch, kontraproduktiv und chaotisch – oder sind trotz allem positive Lichtblicke auszumachen? Zeit, vor allem ökonomisch Bilanz zu ziehen.
Was anfänglich noch einen gewissen Unterhaltungswert hatte, war plötzlich nicht mehr lustig. Schon sehr bald wurde einem durchschnittlichen Bildungsbürger bewusst, dass es gar nicht um „America First“ ging – sondern um „Trump First“.
Trotzdem: Vielleicht war doch nicht alles komplett schlecht und/oder falsch? „Wirtschaftlich hat er einiges getan“ – das hören wir doch hie und da. Wirklich?
Nicht alles komplett falsch
Durchaus berechtigt waren Trumps Überlegungen in Sachen Steuersenkungen. Nebst den sehr hohen Spitzensteuersätzen für natürliche Personen waren insbesondere die Unternehmenssteuern von 35% nicht mehr auf einem wettbewerbsfähigen Niveau. Aber das Vorgehen des autokratisch und selbstherrlich agierenden Präsidenten war falsch: Die drastische Senkung der Steuersätze (Unternehmenssteuern z.B. auf 21%) führte zu starken Steuerausfällen, welche die Budgetdefizite der grössten Volkswirtschaft der Welt beträchtlich erhöhen. Schon Ronald Reagan – mit Reaganomics – war mit dieser Strategie (zumindest was die Staatsdefizite angeht) gescheitert. Plötzliche Steuersenkungen werden nicht einfach mit plötzlicher Bereitschaft kompensiert, konstant höhere Gewinne auszuweisen. Und keine Volkswirtschaft kann sich so schnell entwickeln, dass blitzartig mehr Unternehmensgewinne ausgespuckt werden können. Der Vorgang ist doch etwas anspruchsvoller, braucht Zeit und muss von einem ganzen Strauss an flankierenden Massnahmen begleitet werden. Corona wirkte dann in diesem Jahr noch als endgültiger Brandbeschleuniger, um die Staatsverschuldung der USA in noch nie gekannte Höhen zu treiben. Das wahlkampf-motivierte Verteilen von Corona-Helikoptergeld machte die Sache dabei nur noch schlimmer.
Zwar repatriierten ein paar grosse Firmen ihre Aktivitäten und vor allem ihre Steuersubstrate in die USA. Auch holten grosse US Konzerne ein paar stille Reserven aus den Kellern ihrer Bilanzen, welche nun, in diesem attraktiven Trump’schen Steuer-Slot, versteuert werden konnten. Optisch sah so 2019 noch alles wie Weihnachten aus, plötzlich wiesen viele Unternehmen schöne Gewinne aus. Das tat auch der Börse gut. Nachhaltig war die Übung indessen nicht, denn die ansehnlichen Wachstumsdaten der Wirtschaft waren nur erkauft. Aber letztlich ging es so oder so nur um den kurzfristigen Erfolg eines Egozentrikers und seine geplante Wiederwahl.
Ein zweiter Punkt: Dass die ausufernde Bürokratie eingedämmt werden musste, war klar und somit eine im Grunde kluge Überlegung und ein Versprechen des neu gewählten Präsidenten im Jahre 2016. Aber auch hier scheiterte der Plan, und das Gegenteil fand statt: Viele neue Gesetze wurden eingebracht, ohne auch nur im Ansatz einen konsequenten Rückbau des Verwaltungsapparates und bürokratischen Hindernissen vorzunehmen.
Ein dritter Punkt: Das Misstrauen Trumps gegenüber China war durchaus berechtigt. Diesen Staat also mal in die Schranken zu weisen, war vom Prinzip her nicht falsch. Aber komplett falsch war das Anzetteln eines Handelskrieges, welcher Amerika nur verlieren kann. Die Wettbewerbsfähigkeit der USA hat sich inzwischen klar verschlechtert, und das Handelsbilanzdefizit mit China hat sich nicht verbessert, sondern rückte sogar noch weiter ins Minus. Dass Trump in China den Spitznamen „Trump, the nation-builder“ trägt, spricht Bände: China sieht in Trump einen Beschleuniger des Niedergangs der USA und damit einen „Nation-Builder“ für China…
Der Wirtschafts-Ausweis der Ära Trump sieht bei Lichte betrachtet also gar nicht rosig aus – selbst dann nicht, wenn die Corona-Blessuren ausgeklammert werden.
An vielen Orten gescheitert:
Die weiteren Punkte auf der Versagensliste türmen sich zu einem bemerkenswerten Berg an neu aufgebauten Problemen: Zu nennen sind beispielsweise das Komplett-Versagen in der Corona-Krise oder die weltweit gescheiterte Handels- und Wirtschaftspolitik – nicht nur mit China. Dass die America First-Strategie langfristig ein Schuss ins Knie war, ist wohl den meisten Ökonomen klar. Protektionismus war noch nie ein guter Begleiter für nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Politisch kommt diese nationalistische Strategie indessen immer ganz gut an. Diese populistische Sünde begehen übrigens nicht nur Republikaner – Demokraten ebenso.
Aussen- und innenpolitisch hatte der Trumpismus auch nichts erreicht – ausser Zwietracht gesät und dem Ansehen der Supermacht geschadet. Und mit der Kündigung oder Torpedierung von internationalen Abkommen hatten sich die vom Trumpismus kontaminierten USA – offenbar in ihrem Grössenwahn und damit zusammenhängenden Hang zum Unilateralismus – zusehends abgekoppelt von der Welt.
Und die Schweiz?
Oft gelobt wurden die guten Verbindungen unserer Regierung und Institutionen zur Trump-Administration. Ueli Maurer durfte sogar mal im Weissen Haus vorbeischauen. Aber gebracht hat es schlicht und ergreifend nichts. Im Gegenteil: Die Schweiz blieb z.B. von den neuen Stahlimport-Zöllen der USA nicht verschont. Und das geplante Freihandelsabkommen konnte in den vier Jahren auch nicht abgeschlossen worden.
Komplettes Versagen in der Werte-Wertung
Dass die grösste Wirtschaftsmacht der Welt von einem derart erratischen und ziemlich skrupellosen Hasardeur geführt wurde, hat der gesamten westlichen Welt geschadet. Und sie hat unsere Werte-Wertung durcheinander gebracht. Fake News, Verschwörungstheorien, Verunglimpfungen, Nepotismus und konstantes Lügen kennzeichnen den Trumpismus und wurden an vielen Orten fast salonfähig. Die Orbans, Salvinis, Modis und Bolsenaros dieser Welt klatschten in die Hände – ihnen war der Umstand gleich, dass hier ein Regierungssystem vor sich hin werkelte, welches offenbar ohne moralischen Kompass funktionierte. Gut, ist der Spuk nun vorbei. Zu hoffen bleibt, dass sich allfällige üble Nachwirkungen in Grenzen halten werden. Vermutlich werden wir jedoch mit dem Phänomen der Ära Trump noch weiter zu tun haben – beispielsweise in Form eines skurrilen Schattenkabinetts, als unseliger trumpistischer Strippenzieher der republikanischen Partei oder einer TV-Station mit alternative facts. Oder es bleibt uns ganz einfach vergönnt, die Prozesse und Machenschaften eines geschmacklosen Emporkömmlings aus den Klatschspalten weiterzuverfolgen. Zumindest von der globalen Realpolitik bliebe das Phänomen dann wenigstens ausgesperrt.
Fazit:
Leider gibt es im Trumpismus kaum positive Lichtblicke auszumachen. Ökonomisch und moralisch ist der wirre politische Ausflug gescheitert. Ein paar gute Gedanken waren dabei: wie der Protest gegen die Rücksichtslosigkeit Chinas, der Abbau der Bürokratie oder die Steuersenkungen. Aber entweder blieb es nur bei den Gedanken und leeren Versprechungen oder die Umsetzung scheiterte. Die Bilanz des Trumpismus ist letztlich verheerend – insbesondere was die Vorbildfunktion des vielleicht wichtigsten Staatsoberhauptes der Welt betrifft. Grund genug, diesen Term „Trumpismus“ zum Unwort des Jahres zu küren. True Economics wird ihn, aus Protest, nicht mehr – wirklich nie mehr! – verwenden.