
27.12.2020
Waldmeyer, der Tsunami und das Bargeld
(Für einmal eine wahre Waldmeyer-Geschichte!)

Waldmeyer war schon immer ein grosser Anhänger von Bargeld. Mit Bedauern stellt er heute fest, dass die Notenzirkulation immer bescheidener wird, dass sich elektronische Bezahlmethoden durchsetzen, und – weit schlimmer – er befürchtet, dass uns vielleicht einmal die Abschaffung des Bargeldes droht.
Es waren vor allem Krisenüberlegungen, welche Waldmeyer darin bestärkten, immer einen gewissen Stock an Bargeld zu halten. Zum Beispiel für den Fall eines Tsunamis, wie 2004, nämlich genau gestern vor 16 Jahren. Aber dazu später.
Bargeld, so Waldmeyers Analyse, bringt allerdings nur einen guten Nutzen, wenn es in relativ kleinen Noten gehortet wird. In der Krise wechselt ja niemand gerne, und man müsste dann, zum Beispiel, für fünf Liter Benzin einen ganzen 200-er hergeben. Auch etwas Gold ist empfehlenswert, natürlich auch nur in kleinen Einheiten. Schon Waldmeyers Grossvater erklärte jeweils plakativ, dass man beim Bauern im Notfall immer einen Salami gegen ein Gold-Vreneli eintauschen könnte.
Möchte man sich also intelligent für grosse Krisen vorbereiten, ist das Halten von einem gesunden Stock an Cash absolute Pflicht – und zwar zuhause oder sonst in einem raffinierten Versteck. Denn während der wahren Krise schliessen bekanntlich die Banken, auch die Tresorräume, und man kommt an die Nötli gar nicht mehr ran.
Für Ausland-Aufenthalte indessen hält sich Waldmeyer an eine andere Regel: Man muss immer Noten in US Dollar dabei haben. Spätestens seit Dezember 2004 fühlte er sich darin bestätigt. Das Schicksal wollte es nämlich, dass er sich just zu jenem Zeitpunkt auf den Malediven befand, als dieser ärgerliche Tsunami weite Teil der Welt – und eben auch die schönen Malediven – heimsuchte. Waldmeyer war ein paar Tagen zuvor auf einer dieser eher langweilen Barfuss-Inseln gelandet. Am 26. Dezember 2004 musste er, unverhofft und mit einer gewissen Dringlichkeit, den geschmackvollen, aber bereits wasserumspülten Bungalow mitsamt Charlotte und den beiden kleinen Kindern verlassen. Er fand Zuflucht auf dem höchsten Gebäude der Insel. Der sehr flachen Insel leider.
Waldmeyer hätte anschliessend, zusammen mit einer illustren internationalen Reisegruppe, mit der Schwimmweste auf diesem Flachdach natürlich warten können, bis irgendein Rettungstrupp Hilfe bringen würde. Waldmeyer wäre jedoch nicht Waldmeyer, wenn er nicht selbst die Initiative ergriffen hätte: Es war ihm nämlich nicht entgangen, dass sich am andern Ende der Insel ein Speedboat befand, das einzige auf der Insel. Also bahnte er sich einen Weg durch die überschwemmten Überbleibsel des schönen Eilandes. Er wurde mit dem Bootsführer, nennen wir ihn Baskaran, rasch handelseinig, denn Waldmeyer zauberte elegant zwei 100-Dollar-Noten aus seinem Portemonnaie. Baskaran zögerte nicht lange und navigierte, vorerst alleine, seinen Kahn hochmotiviert und geschickt um die Insel zum Bungalow der Waldmeyers, praktischerweise (aufgrund des Wasserstandes) gleich vors Fenster. Waldmeyer hatte inzwischen seine Familie bereits zurück zum Bungalow gescheucht, und alle konnten, samt Gepäck, in rund 20 Minuten den Flughafen in Malé auf der Hauptinsel erreichen. Ein überfüllter Flieger mit einem Care-Team an Bord brachte die Gestrandeten direkt nach Zürich.
An Bord im engen Gestühl sassen viele der Passagiere mehr oder weniger noch in den Badehosen – was das böse Überraschungsmoment des Tsunamis nochmals verdeutlichte. Die aufmerksame Crew verteilte deshalb sehr schöne schwarze Trainingsanzüge. Gratis. Deshalb die Erwähnung dieses Details: gratis, weil es in der Tat Passagiere gab, die weder Pass noch Geld bei sich hatten. Was Waldmeyer wiederum zur Erkenntnis brachte, dass Bargeld nur hinfällig wird, wenn etwas gratis ist – was sehr selten vorkommt. (Bis heute ärgert sich Waldmeyer allerdings, dass er sich nicht einen dieser Gratis-Trainingsanzüge geschnappt hatte; Charlotte hatte damals protestiert, als er sich einen ergattern wollte.)
Zurück in Meisterschwanden im Wintergarten – es war inzwischen Neujahr im selben Jahr – reflektierte Waldmeyer nochmals alles und fühlte sich sehr relaxed: Das richtige Bargeld hatte ihn gerettet. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er nur Schweizer Franken dabei gehabt hätte. Ob die anderen auf der Insel wohl immer noch auf dem Flachdach hockten…? Waldmeyer merkte sich: Money does not make you rich. Oder: Geld ist nicht alles. Aber Bargeld ist immer besser.
__________________
20.12.2020
Waldmeyer lanciert seine Kryptowährung
Max Waldmeyer hatte eigentlich keine richtigen Geldprobleme. Als Ökonom und ehemaliger Unternehmer hatte er es verstanden, etwas auf die Seite zu legen und zumindest in pekuniären Dingen einigermassen vernünftig zu bleiben. Auch hielt er immer eine stattliche Bargeldreserve. Als Plan B sozusagen, man weiss ja nie. Aber genau hier lag die Krux.
Was ihn nämlich spätestens seit 2010 (der Griechenland- und der Zypernkrise) irritierte: Es kann in wirtschaftlichen Krisen durchaus vorkommen, dass Bankomaten plötzlich kein Geld mehr ausspucken oder Banktresore nicht mehr zugänglich sind. Ergo sollte man die Scheine eben doch besser im privaten Tresor lagern? Nur, was ist, wenn das Bargeld plötzlich abgeschafft wird? Die Schweden z.B. sind ja bald so weit.
Verwirrend sind auch die neuen digitalen Währungen, Bitcoin zum Beispiel. Diese Kryptowährungen waren Waldmeyer noch nie geheuer. Allerdings, der Reiz an ihnen: Eigentlich kann jeder eine solche lancieren. Nebst ein bisschen Informatik brauchte es dazu offenbar nur ein gesundes Mass an Unverfrorenheit und genügend Überzeugungskraft. Die digitale Währung muss auch nicht mit irgendeiner Reservewährung hinterlegt oder abgesichert werden – man schafft sie einfach. Aus dem Nichts.
“Vielleicht sollten wir auch eine eigene Kryptowährung kreieren?”, meinte Waldmeyer zu Charlotte. Ein „Waldmeyer“ könnte z.B. einem Euro entsprechen. Und ein „Waldmeyer“ würde sich in 100 „Dragis“ aufteilen. (Ein Dragi wäre also nicht viel wert, was die Schuld Dragis, des ehemaligen Chefs der Europäischen Zentralbank, an der Entwertung des Euros symbolisieren würde, herbeigezwungen mit seiner zinslosen mirakulösen Geldvermehrung). Da ein Euro heute ein paar Prozente mehr wert ist als ein CHF, wäre mit dem Bezahlen in „Waldmeyers“ auch gleich das Problem mit dem blöden Trinkgeld im Restaurant gelöst – der „Waldmeyer“ enthielte es bereits!

Als Waldmeyer an Freitagabend seinen Porsche Cayenne (schwarz, innen auch) Richtung Zürich zum Tre Fratellinavigierte, meinte er zu Charlotte, triumphierend: “Heute werden wir mit „Waldmeyer“ bezahlen!” Charlotte amüsierte sich: “So, hast du jetzt also deine Kryptowährung lanciert?”
Das Scaloppine al Limone war etwas trocken, dafür der Preis etwas hoch, der Terre Brune jedoch wie immer hervorragend, der Grappa wurde von Luigi offeriert. Waldmeyer fragte Luigi, beinahe beiläufig: “Kann ich heute mit „Waldmeyer“ bezahlen?” “Certo, no è un problema”, antwortete dieser und kritzelte etwas auf einen Zettel.
Charlotte war verblüfft. Luigi akzeptierte also tatsächlich die neue Währung – einfach so? “Klar”, meinte Waldmeyer, “ich akzeptiere sie selber ja auch. Das nächste Mal, wenn wir hier sind, konvertiere ich seine „Waldmeyers“ in CHF und nehme sie zurück.”
“Und das Trinkgeld?”
Stimmt, reflektierte Waldmeyer, vielleicht sollte ein „Waldmeyer“ doch besser einem CHF entsprechen. Das wäre eh sicherer, bei diesen gewaltigen Staatsschulden in den Euroländern.
Was Charlotte nun einleuchtete: Eine Kryptowährung lässt sich offenbar sehr einfach lancieren. Es reicht, wenn man sie selber akzeptiert, angereichert mit der Akzeptanz von ein paar wenigen Anderen. Sie dachte kurz an die Lancierung von „Charlotten“, unterteilt in 100 „Liras“ (als Symbol für Erdogans serbelnde türkische Währung). Sie verwarf den Gedanken jedoch wieder. Waldmeyer schien ihr doch sicherer.
__________________
13.12.2020
Waldmeyer und das Corona-Stübli
Oder die Impfgegner im Séparée.
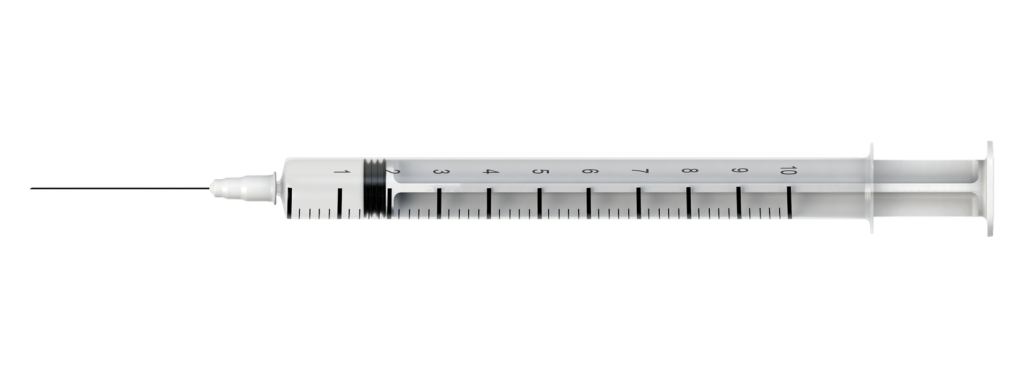
August 2022. Waldmeyer schlenderte mit seinem kleinen Neffen Tim (inzwischen sechsjährig) die Zürcher Bahnhofstrasse rauf und runter. Tim trug sein petrol-farbiges Bändchen am Handgelenk. Das war seit Anfang Jahr das Erkennungszeichen für eine Corona-Impfung. Ganz praktisch, so war sogleich erkennbar, wer geimpft war und wer nicht – und es brauchte dergestalt nur noch Stichproben zur Kontrolle des Impfausweises. Wurde man ohne diesen erwischt (z.B. im Alpamare) musste man eine hohe Busse entrichten – oder alternativ acht Wochen Frondienst in einem Corona-Hospiz leisten.
Nur vereinzelt kamen ihnen Leute mit Maske entgegen, meist mit etwas verstörten, unsicheren Blicken. „Siehst du, das sind Impfgegner“, erklärte Waldmeyer seinem Neffen und freute sich über den edukativen Ausflug in die Stadt. Diese Impfgegner mussten, der Logik gehorchend, eben nach wie vor Maske tragen – gerade jetzt, im August 2022, während der achten Welle. Der vorgeschriebene Mund-/Nasenschutz war ihnen natürlich alles andere als geheuer, denn viele Impf- und Maskengegner hatten im Darknet gelesen, dass vermutlich in allen Masken ein Mini-Chip steckt. Zur Überwachung einfach. Durch das „System“.
A propos Chip: Gabi, Waldmeyers jüngere Schwester (ledig, Zürich, Mobility, Co-Working-Space, Grün-Liberal, viele Apps) hatte den Chip bereits freiwillig implantiert: den Corona-Chip. Er liess sich einfach an der Schulter einpflanzen, kommunizierte mit ihrer Apple Watch, diese mit ihrem Handy, und dieses natürlich mit ihrem Mac Pro IV. Mit jeder Impf-Erneuerung (alle acht Wochen), wurden alle ihre Devices frisch programmiert. So konnte ein Türsteher, z.B. beim Eintreten ins Kaufleuten, den Impf-Stand ganz einfach mit einem kleinen Handgerät überprüfen. Gaby fand das besser, als den Impfausweis nur auf dem Handy zu haben, denn in letzter Zeit wurden viele Handys von Impfgegnern geklaut.
Da war das Leben für Claudia, die ältere Schwester Waldmeyers, schon schwieriger (früh-pensionierte Lehrerin, Otelfingen, SP, Kurzhaarschnitt, lustige farbige Brille). Als überzeugte Impfgegnerin war sie gezwungen, die Fahrpläne von SBB und den Zürcher Trams immer ein bisschen genauer zu studieren: Sie war nämlich auf den für Impfgegner reservierten Corona-Express angewiesen, und der kam nur etwa stündlich. Es gab auch oft Verspätungen, vor allem in Zürich, weil die maskierten Tramführer verpflichtet waren, die Wagen nach jeder siebten Haltestelle gut durchzulüften.
„Komm, wir schauen noch kurz bei Luigi vorbei, im Tre Fratelli. Er hat umgebaut!“, meinte Waldmeyer zu Tim. Luigi hatte nämlich das Fumoir in ein Corona-Stübli umgewandelt. Die neuen Gesetze gegen Diskriminierung liessen es nicht mehr zu, nur geimpfte Gäste reinzulassen. Künftig kam man mit dem Petrolbändli oder dem Handy (auch dem Schulterchip) zwar ungehindert ins Restaurant – aber man musste eben, ohne Impfausweis und etwas weniger elegant, in einen Nebenraum ausweichen. Waldmeyer entdeckte in diesem neuen Stübli nebenan, mit einer dicken Glaswand hermetisch abgeschlossen, seinen Nachbarn Freddy Honegger und Bettina. Bettina – wie wir schon wissen – war nicht nur eine fundamentalistische Impfgegnerin, sondern auch eine überzeugte Verschwörungstheoretikerin. Honeggers waren deshalb ziemlich erleichtert, als Claus Schwab im letzten Januar, während des WEFs auf den Komoren, einen Hirnschlag erlitt. Claus Schwab stand ja, sekundiert von Bill Gates und dem guten alten Soros, hinter der ganzen Corona-Inszenierung. Nun schlürften die Honeggers einen Espresso, wirkten allerdings ein bisschen verloren in dem leeren und nur rudimentär eingerichteten Séparée. Aber so durften sie immerhin die Maske kurz ablegen.
Tim beobachtete konsterniert Honeggers Hund unter dem Tisch. „Wieso trägt Hektor eine Maske?“, fragte er. „Das ist Vorschrift, Tim“, wusste Waldmeyer schlagfertig zu antworten, „Hektor trinkt nichts, also muss die Maske aufbleiben.“
Freddy und Bettina schienen beide Ferienprospekte mit Edelweiss-Flügen zu studieren. Das war kein Zufall, denn seit Anfang 2022 hatten sich die meisten Airlines entschieden, nur noch Passagiere mit Impfausweis zu transportieren. In Ländern mit den neuen Impf-Diskriminierungsgesetzen wichen die Airlines auf separate Carriers aus, welche nur für Impfgegner reserviert waren. So zum Beispiel auf Condor oder eben auf Edelweiss. Aus Sicherheitsgründen waren, so bei Edelweiss, jedoch insgesamt fünf Corona-Tests vorgeschrieben: der erste bei der Buchung, dann 72 Stunden vor dem Einchecken, anschliessend nochmals ein Schnelltest unmittelbar beim Einchecken, dann auf Langstreckenflügen ein zusätzlicher Test kurz vor der Landung (falls positiv, sitzen bleiben). Und ein fünfter Test stand bei der Immigration am Zielort an. Plus, natürlich, Quarantäne, bis der PCR-Test Entwarnung gab. Die Flight Attendants rekrutierten sich ebenso aus Impfgegnern, selbstredend trugen sie vorschriftsgemäss Maske (vor, während und nach dem Flug). Zugegeben ein bisschen mühsam, aber für viele immer noch besser als nicht fliegen – und besser als impfen.
Da war es im Kino schon einfacher: Als Impfgegner durfte man einfach in die für sie reservierte Vormittags-Vorstellung. Anschliessend wurden die Kinos immer kräftig gelüftet.
Das mit den Masken liess Tim keine Ruhe, und das mit den Impfungen war ihm auch nicht klar. Tim unterbrach also Waldmeyers weitere Beobachtungen der Honeggers hinter dem Glas und fragte: „Und was ist mit Sputnik?“ „Eine gute Sache“, erwiderte Waldmeyer, „der Putin hat den Impfstoff sogar an seinen Töchtern getestet“. „Nein, ich meine doch mein Büsi!“, fuhr Tim dazwischen. Stimmt: Tims Büsi hiess auch Sputnik. Und Katzen können auch Corona kriegen, das war seit Weihnachten 2020 bekannt. „Also“, meinte Waldmeyer, „kein Problem, Sputnik könnte vermutlich Edelweiss fliegen.“
____________________
6.12.2020
Waldmeyer stellt einen Affen ein
Max Waldmeyer war doch etwas nachdenklich gestimmt, als er von der baselstädtischen Volksinitiative hörte, welche „Grundrechte für Primaten“ anstrebt. Waldmeyer wusste noch vom Biologieunterricht am Gymnasium, dass auch Menschen Primaten sind – eine für ihn eher groteske Vorstellung. Nun sollten also alle Primaten – eben auch die nicht-menschlichen Affen – ein in der Kantonsverfassung verbrieftes „Recht auf Leben“ sowie ein „Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit“ erhalten. Soviel zur Abstimmung demnächst in Basel.
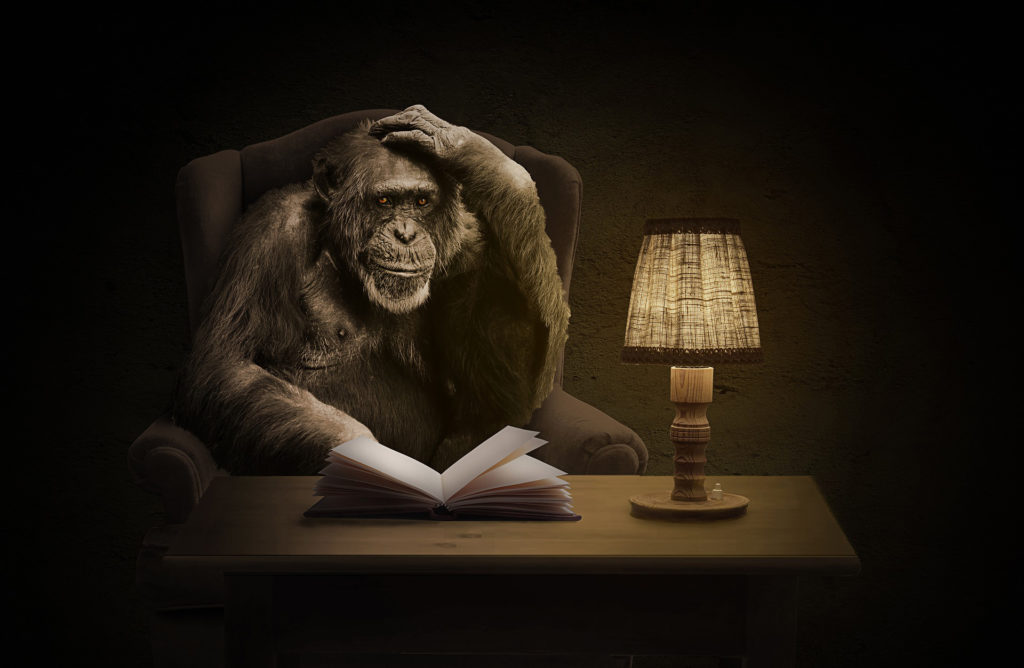
Affen können durchaus emotionale Ähnlichkeiten mit unserem Homo Sapiens aufweisen – das wusste Waldmeyer wiederum von den Daktari-Filmen. Was er allerdings ebenso wusste: Extremen Tierschützern geht es nur vordergründig darum, einen Schimpansen zu einem Rechtssubjekt zu machen. Hintergründig streben sie Grundrechte für die ganze Tierwelt an. Grundrechte also auch für die Vorstufe des Rib-Eye-Steaks oder der Lachsschnitte. Waldmeyer könnte in der Folge seine Grillabende in Meisterschwanden vergessen. Und hier hörte der Spass auf.
Ob Menschenaffen künftig auch einen Fahrausweis beantragen können? Ja, vermutete Waldmeyer, zumindest in der Stadt Basel. Denn würden die Behörden dies einem unbescholtenen Gorilla verwehren, würde die Stadt wohl mit einer Sammelklage der Affen eingedeckt.
Ein positiver Ausgang der Abstimmung könnte jedoch auch Vorteile bringen: „Charlotte, ich könnte einen Affen als Fahrer einstellen. Ich würde ihn dann Covid nennen.“
„Dann kriege ich einmal die Woche eine Schimpansin zum Bügeln, eine Covida“, entgegnete Charlotte sofort.
Waldmeyer stellte sich vor, dass er dann nur ein kurzes “Covid, hol schon mal den Wagen“ murmeln müsste. So, wie Derrick zu seinem Assistenten Harry. Er würde sich hinten ins weiche Leder seines Porsche Cayenne (schwarz, innen auch) fläzen und tun, was wichtige Leute tun bei solchem Nichtstun: die Landschaft geniessen, Zeitung lesen, einen Tisch im Lieblingsrestaurant reservieren.
„Max, du brauchst doch gar keinen Chauffeur“, unterbrach Charlotte sein singuläres Brainstorming. Stimmt, aber die Vorstellung war dennoch belustigend. Covid würde vor dem Restaurant (Tre Fratelli) den Schlag aufreissen und ein „Enjoy your lunch, Sir!“ hinlegen. In einem etwas gutturalen Englisch, so wie in der Originalversion von Planet of the Apes. Allerdings hätte, in Planet of the Apes, Waldmeyer den Fahrer für Covid spielen müssen, nicht umgekehrt. Denn die Filmregie sah vor, dass Affen dort die Menschen beherrschen. So betrachtet, gehen die Basler Initianten also viel weiter, ihnen geht es um die Gleichberechtigung zwischen Affen und Menschen. Das wäre selbstredend ein Quantensprung, vergleichbar fast, nach 50 Jahren, mit der Einführung des Frauenstimmrechts – ein delikater Gedanke, den er auf keinen Fall mit Charlotte teilen wollte, denn dies würde wohl nicht gut ankommen.
Das Erbgut von Schimpansen stimmt zu fast 99% mit dem des Menschen überein. Dieser Tatbestand und die möglichen neuen Rechte für die Affenmenschen brachten Waldmeyer auf einen weiteren Gedanken; diesen wollte er Charlotte indessen nicht vorenthalten: „Meinst du, es wird künftig auch Mischehen geben?“ Charlotte antwortete nicht.
Anmerkung der Redaktion: Die Webmasterin wollte sich erst standhaft weigern, diesen Beitrag zu publizieren („Tierversuche, und überhaupt“). Waldmeyer setzte sich allerdings durch – mit dem Argument, er habe eine Mission, die Leute zum Denken anzuregen. Wir überlassen es also dem Leser, diesen Beitrag gelesen zu haben oder nicht.
__________________
29.11.2020
Waldmeyer und der Nerz
Nach dieser nervenden VR-Sitzung in Zürich freute sich Waldmeyer auf einen gemeinsamen ruhigen Abend mit Charlotte. Vielleicht bei einem Glas Terre Brune vor dem Kamin?!
Als er seinen Porsche Cayenne (schwarz, innen auch) in Meisterschwanden rückwärts in die Garage jonglierte – was er immer so tat, weil das Fahrzeug beim Öffnen der Garage dergestalt besser aussah – roch er bereits das verbrannte Buchenholz: Charlotte musste offenbar seine Gedanken erahnt und schon angefeuert haben!

Sie kniete in der Tat vor dem Cheminée, mit verweinten und roten Augen. Und was sie tat, fand Waldmeyer überhaupt nicht lustig: Sie war dabei, ihren Pelz zu verbrennen – einen Nerz.
Selbstredend verlief der Abend nun nicht so, wie geplant. Waldmeyer musste sich auf eine zweistündige Diskussion über die Covid-verseuchten Nerzfarmen in Dänemark einlassen. Die armen Tiere werden nun „gekeult“. Also erschlagen. Alle 17 Millionen – also gut dreimal mehr, als es, zum Vergleich nur, Dänen gibt. Waldmeyer versuchte Charlotte vergeblich davon zu überzeugen, dass diese (wenn auch nicht sehr appetitliche) „Keulung“ nur eine vorgezogene Tötung sei, eine Euthanasie quasi. Spätestens vor der Häutung wären sie so oder so getötet werden, vielleicht einfach ein paar Monate später nur. Ausserdem gab es keinen medizinischen Kausalzusammenhang zwischen Covid und Nicht-Pelztragen. „Glaubst du denn nun im Ernst, dein Pelz könnte verseucht sein?“
Charlotte ging es indessen um etwas ganz anderes. Nämlich um den Abschluss eines traurigen Themas: Nun wollte sie endgültig nichts mehr vom Pelztragen wissen. Den Mantel hatte sie von ihrer Mutter geerbt – allerdings nie getragen. Im Coop in Meisterschwanden geht das nicht, in Zürich ist es zu gefährlich (wegen der Farbattacken) und in St. Moritz waren sie das letzte Mal vor sechs Jahren. Dennoch: Der Pelz war eine Erinnerung. Aber der Wunsch nach einem endgültigen Abschluss des leidigen Pelzthemas wog bei ihr stärker – deshalb dieser pyrotechnische Abschied von dem Teil, wenn auch auf eine etwas melodramatische Weise. Eine vertrackte psychologische Geschichte also.
Was Waldmeyer allerdings mehr interessierte: Wenn nun der Weltmarktführer Dänemark tatsächlich 40% der Weltproduktion vernichtet, was passiert dann? Explodiert der Nerzpreis? Angebot und Nachfrage müssten doch spielen. Vielleicht wäre der – nun leider verbrannte – Nerzmantel plötzlich 100% mehr wert gewesen. Oder tritt das Gegenteil ein? Nerz könnte plötzlich endgültig stigmatisiert sein. Bildungsferne Amerikanerinnen aus dem Rust Belt zum Beispiel könnten Angst haben, sich mit ihrem eigenen Nerz anzustecken. Also könnte die Nachfrage nach Nerzen nicht explodieren, sondern implodieren. Eine Situation wie zurzeit mit der UBS-Aktie: Niemand weiss genau, wohin die Reise geht. Waldmeyer schaffte es nur knapp, Charlotte nicht in seine Überlegungen einzuweihen. Selbstverständlich verfügte er letztlich über genügend Empathie, solche Gedanken jetzt gerade nicht mit seiner Frau zu teilen.
Waldmeyer öffnete nun trotzdem eine Flasche Terre Brune. „Hoffentlich bekommen die Weintrauben nie Corona!“, meinte er zu Charlotte. Aber diese Bemerkung war natürlich ebenso unpassend. Und sie kam auch nicht gut an.
__________________
22.11.2020
Waldmeyer und die rätselhaften Betten
Max Waldmeyer kam aus dem Grübeln nicht heraus: Die Johns-Hopkins-Max Waldmeyer kam aus dem Grübeln nicht heraus: Die Johns-Hopkins-Statistik hatte die Schweiz vor wenigen Tagen auf den weltweit ersten Platz in Sachen Corona-Neuinfektionen gehievt. Doppelt so viele wie in Spanien oder in den USA sind es jetzt täglich, oder viermal mehr als in Deutschland. Immer im Verhältnis zur Bevölkerung gerechnet. We are the Champions!

Aber etwas konnte nicht stimmen: Deutschland verfügt über 28‘000 Intensivbetten, die zehnmal kleinere Schweiz über gut 1‘100 – die Eidgenossen haben also pro Kopf fast dreimal weniger Betten. In beiden Ländern sind diese Intensivbetten jedoch gleich belegt, nämlich zu 75%. Ein mathematisches Rätsel. Fast viermal mehr Infektionen und fast dreimal weniger Betten sollte mindestens zu einem Faktor 10 führen. Mit andern Worten: Eigentlich sollte die Schweiz, so rechnete Waldmeyer, bei theoretisch gleichem Infektionsaufkommen 2‘100 Betten blockieren (21‘000 Deutsche liegen zurzeit intensiv, dividiert durch 10, macht 2‘100). Und weil wir rund viermal mehr Infektionen haben, müssten eigentlich über 8‘000 Schweizer auf den Intensivstationen um ihr Leben kämpfen – zehnmal mehr, als tatsächlich dort liegen. Was auch gar nicht ginge, da wir ja nur gut 1’100 von diesen Betten haben. Merkwürdig. Ein Deutscher ist eben kein Schweizer, sinnierte Waldmeyer.
Charlotte kam gerade von der Tennisstunde zurück. Sie lachte und sah blendend aus in ihrem Outfit. „Was meinst du, warum sind so wenig coronitte Schweizer hospitalisiert?“, rief ihr Max entgegen. Charlottes Antwort kam sofort: „Schau doch zum Beispiel mich an: Wir leben einfach gesünder. Ich treibe Sport, esse nahezu vegetarisch, trinke wenig Alkohol, halte mein Gewicht!“ Ihre Theorie war allerdings nicht ganz schlüssig, denn Waldmeyer tat ziemlich genau das Gegenteil. War er also einfach „deutscher“…?
Waldmeyer analysierte weiter und stellte optional fünf eigene Theorien auf:
- Deutsche sitzen nur Bier trinkend und Chips essend vor dem Fernseher und müssen im Corona-Fall deshalb eher intensiver versorgt werden als die gesund lebenden Schweizer.
- Die deutschen Intensivbetten waren schon vor Corona stark belegt, weil Deutsche sich rascher krankschreiben lassen.
- Das mit den Bettenzahlen in Deutschland ist eine Verschwörung. Der Staat möchte der Bevölkerung nur Angst einjagen und sie mit rigiden Corona-Massnahmen besser kontrollieren. Eigentlich gibt es diese Betten gar nicht und sie sind ausserdem leer.
- Betrug und Verschwörung finden in der Schweiz statt. In Tat und Wahrheit befinden sich tausende von Kranken in geheimen unterirdischen Spitälern und siechen dort in militärischen, schmalen Intensivbetten dahin, betreut von ebenso infizierten jungen WK-Soldaten. Hintergrund: Bundesrat Berset hatte einen Komplott mit der Verteidigungsministerin Amherd geschmiedet, damit die Wahrheit des Führungsversagens in der Krise nicht ans Licht kommt.
- In der Schweiz sind nur die Immigranten aus Ex-Jugoslawien infiziert. Diese sind vor allem jung und stark und merken es gar nicht – und müssen schon gar nicht in diese Betten.
Waldmeyer war selber nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis seiner Analyse. Er textete deshalb kurz seinen sehr zahlenbegabten Freund Patrick Krähenbühl in Dubai an (Informatiker, Ökonom, ex CFO, Unternehmer). Die Antwort, im Sinne einer neuen Rätselauflösung, kam sofort zurück: „Die Schweizer Zahlen stimmen ganz einfach nicht, weil diese das BAG immer noch per Fax einfordert.“
Doch auch diese Antwort half nicht wirklich weiter. Waldmeyer schnappte sich ein paar Chips zum vorgezogenen Apéritif, stellte den Fernseher an und fühlte sich allein gelassen mit all diesen Rätseln. Wie gesagt: Etwas stimmte nicht.
___________________
15.11.2020
Waldmeyer übernimmt das Corona Management
Oder: analysieren, entscheiden, führen – auch im Schlaf

„Danke, dass Sie Biden gratuliert haben“, sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zu Waldmeyer, „das war ein wichtiges Zeichen.“
Nur 24 Stunden zuvor war Max Waldmeyer zum Krisen-Koordinator in Sachen Corona ernannt worden. Natürlich war die frühere Konzertpianistin froh, diese lästige Covid-Bürde jetzt endlich abzugeben. Waldmeyer verfügte als ehemaliger CEO, mit einem Master in Ökonomie und als ehemaliger subalterner Offizier zwar nicht exakt über das optimale Anforderungsprofil für dieses Krisenmandat. Aber Waldmeyer wusste zu analysieren, war entscheidungsfreudig und führungserprobt. Wohl deshalb hatte ihn das Parlament gewählt – mit weitreichenden Kompetenzen. Der fünfköpfige Parlamentsausschuss, welcher vorübergehend in Sachen Corona für das gesamte Parlament entscheiden durfte, winkte nun jeden Abend um 18:00 Uhr Waldmeyers Beschlüsse durch. Bis 22:00 Uhr hatten die Juristen in den Bundesämtern jeweils Zeit, die Verordnungen sauber zu formulieren. Punkt 22:30 wurden sie unterschrieben und traten sofort in Kraft. Selbstverständlich könnte ein Referendum gegen jede Verordnung ergriffen werden – was dann allerdings erst nach der Coronazeit greifen würde.
Natürlich befand sich Waldmeyer im tiefen REM-Schlaf – es war alles nur ein Traum. Wieder einmal einer dieser Zukunftsträume, welche Waldmeyer in letzter Zeit oft heimsuchten.
„Das Briefing findet um 10:00 Uhr statt, es ist jetzt 09:53 Uhr“, meinte Frau Silivič. Waldmeyers ehemalige rechte Hand aus seiner Unternehmerzeit amtete nun als persönliche Krisenassistentin.
Alle waren versammelt: Vertreter der Kantone und der betroffenen Bundesämter, der wichtigsten Behörden, der Armee, des Zivilschutzes. Ein paar neugierige Bundesräte hörten auch zu. Berset fehlte, dieser hatte schon vor drei Wochen seinen Rücktritt bekanntgegeben (er leitet nun eine Berufsschule in Romont FR, in Teilzeit, immerhin in seinem Heimatkanton).
Waldmeyer hatte ein dünnes A4-Papier vor sich, auf welches er in groben Zügen eine Kurzanalyse und einen Massnahmenplan gekritzelt hatte. Aber er brauchte das Papier gar nicht.
„Das Problem haben wir erkannt – also setzen wir jetzt auch genau dort an: bei den höchsten Übertragungswahrscheinlichkeiten. Es bleibt bei den Schliessungen von Clubs und dergleichen, in Restaurants dürfen nur noch Dreiertische bedient werden – mit Abstand, und man darf nicht vis-à-vis sitzen. Die Sperrstunde wird auf 21:30 Uhr vorverlegt. Fitnesscenter, Kosmetikstudios, Gotteshäuser, Sambaschulen und Ähnliches müssen ab Montag schliessen. Alle Veranstaltungen müssen abgesagt werden – das schliesst sogar Jodlerfeste und Hornussen ein. Hochzeitsfeiern müssen leider auf zwei Personen beschränkt werden – ausser das Paar kommt aus der gleichen Familie. Alle privaten Feiern ausserhalb von zwei Haushalten werden verboten; die Gemeinden machen Stichproben und müssen Plakate auch in serbokroatischer und albanischer Sprache aufhängen. In den Schulen werden ab Kindergartenstufe Masken getragen – ja, wie in Asien. Und die Maskentragpflicht wird jetzt endlich durchgesetzt. Die Busse für Vergehen wird auf 250.- CHF erhöht, im Wiederholungsfall wird ein achtwöchiger Sozialdienst in einem Alters- oder Asylantenheim angeordnet.“
Alle Beteiligten nickten. „Finalmente!“, murmelte der zugeschaltete Cassis. Der ehemalige Bundesrat führt seit letzter Woche das Kantonsspital in Bellinzona. Waldmeyer fuhr fort: „Vulnerable Personen werden ab sofort besser geschützt. Das Pflegepersonal muss sich zweimal pro Woche testen lassen. Und Personen aus Risikogruppen mit hohem BMI dürfen das Haus erst verlassen, wenn ihr BMI unter 30 gesunken ist.“
Waldmeyer blickte kurz zu seiner Chef-Psychologin in der hintersten Reihe: „Tamara Hügli, wie läuft’s mit den Incentives in Sachen Homeoffice?“ „Wir werden mit Nestlé zu einem Abschluss kommen: Alle Kaffeemaschinen werden aus den Büros geholt und kommen in die Privathaushalte, und Nespresso wird alle Homeoffices einen Monat lang gratis mit Kapseln beliefern.“ Waldmeyers Gesicht hellte sich auf. Auf die Industrie war einfach Verlass. „Gut so, weitermachen, Tamara.“
Waldmeyer wandte sich zu den Vertretern des BAK (Bundesamt für Krankheit): „Und ihr konzentriert euch jetzt ab sofort auf die Zahlen. Die Fallzahlen werden künftig auch am Wochenende kommuniziert. Und erzählt mir nicht wieder, dass die Übertragungen einfach in der Familie stattfinden – das Virus steigt nicht wie der Samichlaus durch den Kamin rein. Ich möchte ab sofort täglich eine Übersicht der Primärübertragungen sehen. Noch was: Alle Faxgeräte werden noch diese Woche entsorgt – M-Electronics nimmt sie kostenlos zurück, wir akzeptieren dabei deren Wunsch, ihre bescheidene Laden-Frequenz auf diese Weise etwas erhöhen zu können. Was läuft eigentlich in diesem Shisha-Club in Spreitenbach?“
Waldmeyer wartete die Antwort nicht ab und wandte sich nun an den Korpskommandanten: „Thomas, wann stehen die Testcenter?“ „In 48 Stunden sind die 50 Drive-throughs mit den Schnelltests betriebsbereit. Für die weiteren 50 Testcenter in den Ballungsgebieten brauchen wir 18 Stunden länger.“
„Prima, das läuft also. Wo stehen wir beim Tracing?“ Der Koordinator der Kantone, Hansueli Loosli – bis vor kurzem noch im Sold von Coop und der Swisscom – meldete sich: Die Arbeitsämter seien jetzt umfunktioniert, die Kurzarbeitenden aus den tertiären Sektoren seien während 24 Stunden täglich am Tracen. Die Rechnung der Swisscom würde etwas höher ausfallen. „Aber wir erwischen nun jeden.“
Waldmeyer nickte zufrieden und liess sich noch kurz per Zoom vom zugeschalteten Spitalkoordinator Daniel Füglister – vormals ein bekannter Hotelier – orientieren: Die Spitalbataillone von Thomas Süssli hätten nun alle Notzelte vor den Spitälern aufgebaut. Dort würden jetzt bereits normale Erste-Hilfe-Dienstleistungen erbracht, um die Spitäler zu entlasten. Auch kleinere Eingriffe werden vorgenommen. „Bis wie weit gehen diese denn?“, wollte Waldmeyer wissen. „Nun, Herztransplantationen machen wir keine. Aber eine normale Geburt liegt schon drin.“ Waldmeyer war beruhigt.
Er war auch beruhigt, dass die Wirtschaft weiterlief – wenn auch viele aus dem Homeoffice arbeiteten oder dergestalt eben nicht arbeiteten. Zumindest blieben alle Geschäfte offen. Und so wie es aussah, würde das Ausland nächstens auch wieder Schweizer einreisen lassen. Waldmeyer seufzte kurz auf im Schlaf: Er hatte den kompletten Lockdown verhindert.
Am nächsten Morgen beim Kaffee sondierte Charlotte, ob Max wieder geträumt habe. Und was mit diesen Geburten sei. „Ach weisst du, es war wieder so ein Einsatz.“ Charlotte tat, was sie immer tat bei solchen Situationen: Sie schüttelte den Kopf und sagte nichts. Auf Radio SRF war Berset zu hören: „Es iss fünfvorzwölf. Wir müssen nun einfach entscheiden, ob wir die Lage dringend beobachten sollen!“
_____________________
8.11.2020
Was macht Bruno Spirig…?
Oder warum Waldmeyers Cousin gerade jetzt in deutsche Restaurants investiert
Facetime: Bruno Spirig wollte sich heute aus München melden. Er war ziemlich aufgeräumt und grinste Waldmeyer mit seinem braungebrannten Gesicht aus dem Smartphone entgegen. Partymusik lief im Hintergrund. Bruno wollte Waldmeyer „Hammer-News“ durchgeben.
Doch dazu später. Erinnern wir uns erst nochmals, was bisher geschah: Waldmeyers Cousin Spirig war immer schon etwas windig. In den Neunziger-Jahren musste er sich wegen irgendeiner dubiosen Geschichte nach Brasilien absetzen, und diesen Frühling erschlich er sich parallel gleich drei Coronakredite auf seinem konkursiten Take-away in Schwamendingen; er setzte sich in der Folge nach El Hierro ab. Zu allem Übel war diese kleine Kanareninsel auch noch Waldmeyers Tipp zum Untertauchen: äusserst günstig, angenehmes Klima, weitgehend unbekannt, auch weit weg – und trotzdem in Europa. Bruno hatte sich gleich eine kleine Villa gekauft, betätigte sich inzwischen als erfolgreicher Immobilienmakler und sorgte mittels Multiplikator-Effekt für makroökonomische Fortschritte auf dem pittoresken Eiland. Man sprach bereits davon, ihm auf dem Dorfplatz in Valverde eine Statue zu errichten („Bruno el suizo, libertador de El Hierro“).
Bruno hatte sich also gut etabliert. Und nachdem Ueli der Maurer die Coronakredite soeben bis 2028 verlängert hatte, wähnte er sich erst recht in Sicherheit. Aber Bruno war umtriebig, deshalb München.
Also zurück zu unserer Facetime-Unterhaltung: Bruno Spirig war nicht entgangen, dass der deutsche Staat ab 1. November die zwangs-geschlossenen Restaurants mit 75% des Vorjahres-Umsatzes entschädigt. Also nicht den Gewinn oder die Marge kompensiert, sondern tatsächlich den Umsatz. „Die Idee mit den 75% kommt ja von diesem Scholz“, meinte Bruno Spirig, „der Sozi ist zwar Jurist, hat aber wohl noch nie eine Kalkulation einer Kneipe gesehen, he, he…!“
Waldmeyers Cousin rapportierte weiter: Bruno hatte sich offenbar – notabene für einen Apfel und ein Ei – El Español, eine kleine Restaurantkette in München, gekauft. Und zwar rückwirkend, zudem mit Bankzinsen, die nahe bei Null liegen. Zuvor hatte er sich auch noch Wien angeschaut, denn in Österreich werden gar 80% des Umsatzes vergütet. Aber die Flugverbindungen von München auf die Kanaren sind einfach besser.
Bruno Spirigs Rechnung leuchtete Waldmeyer in der Tat ein: Der Wareneinsatz eines Restaurants liegt, je nach Konzept, bei ca. 28% des Umsatzes. Personalkosten entfallen zurzeit fast zur Gänze, denn ein Grossteil der Beschäftigten wurde schon früher ausgestellt oder befindet sich in Kurzarbeit. Die Ladenmiete konnte für die Coronazeit drastisch runtergehandelt werden, viele andere Kosten für Energie- und Unterhalt entfallen ebenso. Ergo verbleiben von den 75% gut 2/3 in der Kasse. Ein gutes Geschäftsmodell. Zudem besteht die Chance, dass nicht nur Corona, sondern auch die deutschen Staatshilfen noch etwas länger andauern könnten. „Und wenn‘s dann wieder aufwärts geht, verkaufe ich den Laden mit Gewinn. Buy low, sell high – das hast du doch immer gepredigt, nicht…? Vielleicht zahle ich dann dem Maurer diese Coronakredite zurück, und zwar frühzeitig, noch vor 2028.“
Dann hätte, mit Brunos Geschäftsmodell, Deutschland de facto den Schweizer Staat subventioniert, analysierte Waldmeyer. Nicht so wie mit der Swiss – dort ist der Vorgang ja umgekehrt.
Er erhaschte auf dem Bildschirm im Hintergrund ein paar unscharfe Strandbilder, es räkelten sich ein paar Frauen beim Sonnenbad. Aber Waldmeyer wunderte sich, dass man sich im November in München irgendwo an den Strand hinfläzen konnte. „Bist du wirklich in München, Bruno?“

„Nein, nein! Ich bin doch nicht blöd, sieh dir das Wetter auf El Hierro an! Und wieso soll ich in München sein, wenn die Kneipen geschlossen sind!?“
Vielleicht hatte Bruno Spirig recht, reflektierte Waldmeyer weiter: Leben, Arbeit und Geschäft finden künftig vorab virtuell statt. Im gelebten Konjunktiv quasi. Bruno schien sich in seinem „Homeoffice“ auf jeden Fall gut eingerichtet zu haben.
_______________________
1.11.2020
Max Waldmeyer entdeckt den Covid-helveticus
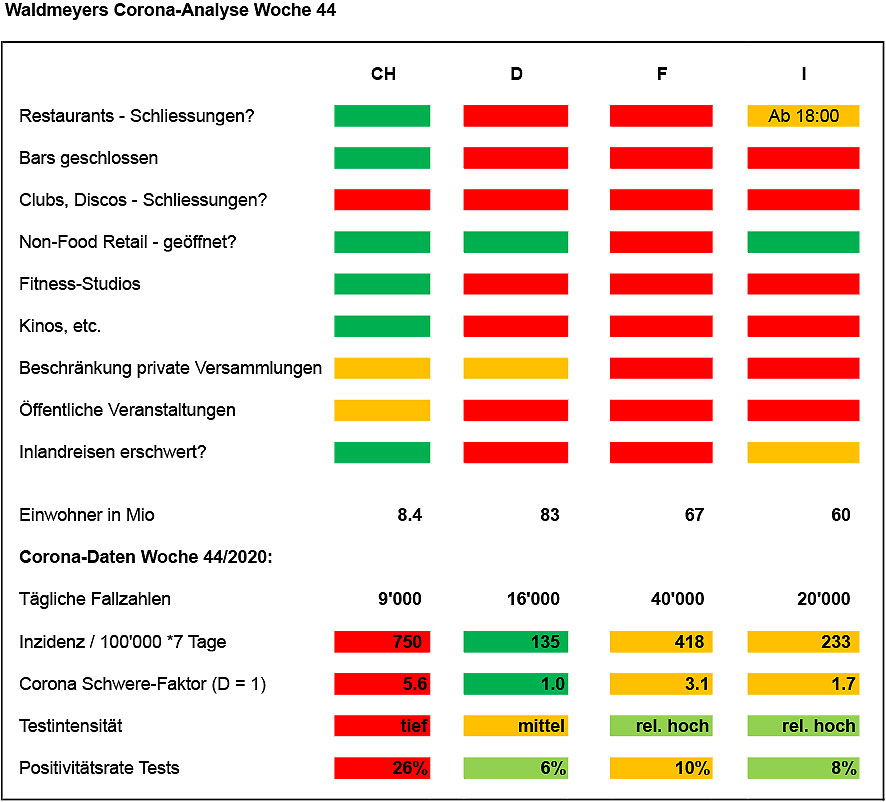
Waldmeyer war diese Woche beeindruckt von den Brandreden und den angekündigten neuen Corona-Massnahmen: von Angela Merkel (betrübt, mahnend, dosierte Panik, etwas erschöpft, wohl schlecht geschlafen), Conte (staatsmännisch, gut gekleidet, souverän), Macron (eine gewisse Brillanz war auszumachen, Grandezza, auch Pathos). Und dann unser Dream-Team im Bundesrat, ohne nur einen Anflug von Brandrede: Sommaruga-Berset-Parmelin – alle ziemlich unaufgeregt, eher gelangweilt. Unsere Konzertpianistin wiederholte die Solidaritätsappelle, der Jurist Berset delegierte die juristischen Fragen der Journalisten elegant an Subalterne, unserem Winzer Parmelin war die Angelegenheit eh lästig. Immerhin konnte er in den letzten Wochen in episch langen und mühsamen Diskussionen mit den Kantonen und allen Bundesratskollegen die Polizeisperrstunde auf 23:00 Uhr hochdrücken. Zumindest bleiben die Restaurants nun fast uneingeschränkt offen – ganz im Vergleich zu all unseren Nachbarn rund um die Schweiz. Ob nun wohl die Italiener zum Dinner raufkommen nach Lugano, die Elsässer in Basel einfallen, oder die Deutschen Schaffhausen heimsuchen – oder gibt es gar einen Run auf die „Züricher“ Gastrotempel?
Waldmeyer stand jedoch vor einem Zahlensalat: Wo stand nun die Schweiz tatsächlich? Und wie im Vergleich zu unseren Nachbarn? Er setzte sich hin und brachte alles – so wie früher als CEO – auf ein einziges A4-Blatt. Auch Präsident Reagan wollte es früher so („there is no problem bigger than a sheet of paper“ – oder ähnlich). Waldmeyers Analyse war verblüffend: Obwohl die Schweiz, im Vergleich zu allen unseren Nachbarn, mit Abstand die dramatischsten Corona-Zahlen aufweist, nehmen sich die staatlichen Einschränkungs-Massnahmen mit Abstand am zahmsten aus. Wir scheinen die Lage also unter Kontrolle zu haben.
„Charlotte, ich habe für heute einen Tisch im Tre Fratelli reserviert. Bevor alle Deutschen kommen. Uf di achti!“
„Charlotte freute sich: „Prima! Da kann ich ja vorher noch etwas shoppen bei Grieder! Wir treffen uns dann in der Kronenhalle-Bar. Neu müssen wir uns dort zwar hinsetzen, gell. Und denk daran, das Tre Fratelli schliesst jetzt schon um 23:00 Uhr.“
„Kein Problem“, meint Max, „wir können den Grappa ja später bei Reto und Ursula nehmen. Vielleicht kommen Harry und Mia noch dazu.“
Waldmeyer war beruhigt: Das Leben geht normal weiter. Die Schweiz scheint ein Fels in der Brandung zu sein. Natürlich wusste er, dass in unserem Land relativ wenig getestet wird, so sehen die Infektionszahlen etwas besser aus. Mehr Tests würden dem statistischen Bild schaden. Die Lage würde dann unnötigerweise noch coronitter aussehen. Rundherum also nichts als Panik, und nur die Eidgenossen scheinen die Lage im Griff zu haben. Unsere Bedächtigkeit und Coolness machten sich also wieder einmal bezahlt. Ein Glück, sind wir nie der EU beigetreten! Es gab eigentlich nur eine Erklärung für die eklatanten Unterschiede in der Lagebeurteilung und den Corona-Massnahmen: Dieses lästige Virus konnte in ganz Europa unmöglich dasselbe sein. Es gibt bestimmt Mutanten. Die schweizerische Covid-helveticus Variante scheint mit Abstand die harmloseste zu sein.
____________________
25.10.2020
Waldmeyer und der BMI, Teil 3 (von 3):
Waldmeyers Sorge: Der Digitalisierungsschub erhöht den BMI
Was bisher geschah – bzw. was Waldmeyer bisher in Sachen BMI analysierte:
Waldmeyer hatte sich schon vermehrt mit dem Body Mass Index auseinandergesetzt. So machte er eine direkte Korrelation zwischen dem Gastronomielevel eines Landes und dem BMI der Bevölkerung aus. Er überlegte sogar, aus optischen Gründen künftig nur noch in Länder mit niedrigem BMI zu reisen. Er studierte auch die Corona-Effekte auf den BMI. Und stellte grundsätzlich fest, dass die Welt zusehends verfettet.

Dabei gab sich Waldmeyer Mühe, das Big Picture nicht aus den Augen zu verlieren. Deshalb seine heutige Reflektion in Sachen Digitalisierung und BMI. Es ging ihm dabei nicht um die digitalisierte Branche, wo die Nerds mit Kapuze programmieren und gleichzeitig Burger vertilgen und Cola schlürfen. Es ging ihm eher um den jüngsten Digitalisierungsschub, ausgelöst durch Corona – aber nicht um die aktuelle Corona-Misere an sich, sondern um die längerfristig fatalen Auswirkungen auf die Ernährung und damit auf den so befeuerten BMI.
Mit der online Bestellung entfällt die Scham
Je mehr Homeoffice, desto mehr Essen wird auswärts bestellt und desto ungesünder wird generell verpflegt. Denn in dieser Konstellation steht tendenziell eher Convenience Food im Kühlschrank. Dass das Homeoffice den BMI noch oben treibt, ist damit eigentlich evident. Nun kam aber ein zusätzlicher Effekt des Digitalisierungsschubs in der Gastronomiebrache hinzu: Mit den online Bestellungen entfällt nämlich die Scham. Es wird mehr bestellt, als man normalerweise, also offline und unter Beobachtung, bestellen würde. Dergestalt wird mehr gegessen – was sich in relativ kurzer Zeit in der Erhöhung des Body Mass Indexes niederschlägt.
Je digitaler unser Leben wird, so reflektierte Waldmeyer, desto schlechter und desto mehr wird gegessen. Und desto eher erhöht sich der BMI. Ein Point of no Return?
Immer mehr XL-Portionen
Waldmeyer hatte sich selber schon dabei ertappt, dass er bei der Auswahl oft dazu tendiert, die mittlere Grösse zu ordern (Charlotte nimmt in der Regel die kleine). Nur: Die grösste Grösse war eigentlich gar nie für den Konsum gedacht. US Amerikaner haben diese schon vor Jahren nur als virtuelle Benchmark erfunden, um (die bereits zu grosse) mittlere Grösse an den Mann zu bringen. Ja, so bestellt sich eine mittlere Portion leichter, ohne schlechtes Gewissen. Allerdings krallen sich derweil insbesondere Amerikaner, aber auch Briten und Australier trotzdem immer öfter die XL-Portionen – was sich inzwischen im Strassenbild dieser Länder unübersehbar bemerkbar macht.
Digital wird ungehemmter konsumiert
Die Digitalisierung führt also zu mehr Onlinebestellungen, welche ungehemmtere anonyme Orders mit grösseren Portionen auslösen. Das Phänomen zeigt sich auch bei den Bestellungen in den Filialen der Fastfood-Ketten: Seit die Kunden die Bestellung selber an den Touchscreens eingeben können, wird mehr bestellt. Laut McDonalds plus 30%: eine grössere Cola, zwei Burger – und nicht einer. Dazu ein Smoothy (früher keiner). Erst Corona befeuerte diesen jüngsten Digitalisierungsschub, und er hat nun die Fastfood-Lokale erreicht. In irreversibler Form wohl.
Kollektive Schuld der Amerikaner
Waldmeyers Meinung: Amerika trifft eine kollektive Schuld an der Verfettung der Weltbevölkerung. US Amerikaner haben das Fastfood erfunden, welches die ganze Ernährungsmisere erst einleitete. Ursprünglich waren es zwar die Asiaten, die Fastfood im ursprünglichen Sinne mit ihrem „Streetfood“ einführten. Aber die Asiaten verarbeiteten frische Produkte, es wurde gekocht – auch heute noch, ebenso für den raschen Verzehr, aber nicht mit ungesundem, übersüssem und überfrittiertem „Processed Food“. Die Amerikaner kombinierten ihre degenerierten Ernährungsangebote zudem mit perfidem Marketing. Die kollektive Schuld ergibt sich also nicht nur beim Braten der Burger, sondern auch bei deren Vermarktung. Die immer grösseren Portionen schlagen nun weltweit auf die Hüften, und die elektronischen Vermarktungsmöglichkeiten wirken als Brandbeschleuniger.
Ja, der eigene BMI stand für Waldmeyer weniger zur Debatte, spannender war selbstredend jener der andern. Waldmeyer meinte zu Charlotte: „Wir haben ein weltweites BMI Problem.“ Charlotte entgegnete sybillinisch: „Wolltest du heute nicht ins Gym?“
____________
18.10.2020
Waldmeyer und der Body Mass Index – Teil 2 (von 3):
Waldmeyer entdeckt den Zusammenhang zwischen Corona und dem BMI
Waldmeyer hatte sich schon länger mit dem BMI auseinandergesetzt. Weniger mit seinem eigenen, als mit dem seines Umfeldes. Auch entdeckte er eine interessante Korrelation zwischen dem BMI und der Gastronomie eines Landes (siehe Waldmeyers Bericht vom 12. Oktober 2020). Spannend fand er nun die Frage, wie sich ein Zusammenhang zwischen der Corona-Pandemie und dem BMI herauslesen liess. Beim gepflegten Essen zu Hause reflektierte Waldmeyer am liebsten – selbst dann, wenn es sich nur, wie heute, um einen profanen Teller Spaghetti mit einem einfachen Glas Rotwein handelte.

BMI beeinflusst Corona
Was bekannt ist: Ein hoher BMI stellt eine Vorerkrankung dar und beeinflusst den Krankheitsverlauf von Covid-19. Das ist evident, interessierte Waldmeyer im Moment jedoch nicht weiter. Die Umkehrfunktion ist spannender: Wie beeinflusst Corona den BMI?
Lockdowns und Homeoffice als BMI-Treiber
Die Negativeffekte von Corona liegen auf der Hand – insbesondere die Auswirkungen der Lockdown-Perioden: Keine frische Luft, eingesperrt, wenig Bewegung, Sport nur eingeschränkt, Fertigpizza zuhause. Die Fettleibigkeit nimmt zu. Schlimmer noch die Spätfolgen: Vielleicht reduzieren alle diese negativen Effekte – mit dem Resultat des erhöhten BMIs eben – die Lebensjahre. Die Wirkung von Corona könnte also wie Rauchen sein, dachte sich Waldmeyer.
Die Lockdowns hatten bekanntlich auch positive Effekte: So ging die Kriminalität zurück, auch die Strassenunfälle. Waldmeyer ging es jedoch um den BMI. Analytisch nicht einbeziehen wollte er gewisse Kollateralschäden der Lockdowns: häusliche Gewalt, Depressionen, Trunksucht, etc. Obwohl auch diese Einflüsse den BMI erhöhen könnten. Zu kompliziert. Er konzentrierte sich in der Folge auf direkte Einflüsse.
Es ging ihm dabei nicht nur um die Frage, ob während der Corona-Zeit grundsätzlich mehr oder weniger gegessen wurde. Nein, interessant schien ihm auch die Frage, ob es diesbezüglich Länder-Unterschiede gab. Vorab schon: Ja.
Entwicklungsländer: BMI fällt
Nigeria zum Beispiel liefert einen sehr guten Anschauungsunterricht – eine eher tragische Beobachtung allerdings: Die 5 Wochen Lockdown in der Hauptstadt Lagos führten zu 5 Wochen Hunger. Und Hunger schwächt. Der BMI wird bei geschätzten fünf Millionen Einwohnern also sinken. Vielleicht um 5 Punkte. Waldmeyers Konklusion deshalb: Ja, in eher armen Ländern reduziert Corona den BMI.
Industrieländer: BMI steigt
Waldmeyer vermutete, dass in den Industrieländern die Lockdowns und andere Einschränkungen sowie das verbreitete Homeoffice den BMI flächendeckend erhöhten. Dies einerseits aufgrund der verordneten Bewegungsarmut, mit der Folge von Muskelabbau, bzw. Fettaufbau. Dazu kam die schlechtere Verpflegung: Die Leute assen ungesund und unregelmässig – oder laufend. Sie konnten nur beschränkt ausgehen, die Betriebskantinen waren geschlossen. Und selber kochten die Leute nicht so richtig – weil sie es vielleicht nicht können. Oder buken einfach zu viele Kuchen zuhause. Was sicher ist: Die Take-aways und online Bestellungen von Junkfood verschlimmerten die Sache.
Besonders dramatisch wirkte sich die Situation wohl im Fastfood-Gürtel aus (Nordamerika, UK, Australien): Da die Bevölkerung dort das Kochen komplett verlernt hat (oder tatsächlich nie beherrschte), wirkte sich das gastro-soziale Verhalten vermutlich besonders BMI-fördernd aus. Angelsächsisch geprägte Länder waren von dem Phänomen markanter betroffen, romanisch geprägte etwas weniger. Interessant wäre eine Analyse der Länder ausserhalb des Fastfood-Gürtels, aber mit dennoch einfacher Gastronomie: Deutschland, Holland, etc. Wie sich dort der BMI wohl entwickelt hatte?
Ausreisser: z.B. Spanien
Ein besonderes Phänomen galt es in Spanien zu beobachten. Spanien ist nicht unbedingt ein reiches Land, jedoch einigermassen entwickelt. Gastronomisch immerhin im Mittelfeld. Aber ein fatales Food-Management während des mehrmonatigen Lockdowns führte zu einem Ernährungs-Gau: In Spanien werden die Schüler nämlich täglich an den Schulen verpflegt – was sich inzwischen zu einer wichtigen sozialen Unterstützung für viele Familien entwickelt hat. Anlässlich des Lockdowns mit den geschlossenen Schulen blieb der Regierung nichts anderes übrig, als die Gratis-Verpflegung alternativ zu organisieren. Das besonders intelligent handelnde zuständige Familien-Ministerium verteilte kurzerhand Gutscheine von Fastfood-Ketten. Der Effekt: Das Durchschnittsgewicht der Schüler erhöhte sich binnen Wochen um mehre Kilos. Vielleicht irreversibel, überlegte Waldmeyer.
Fazit: ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die Länder
Es kristallisierte sich jetzt heraus, dass Corona natürlich einen Einfluss auf den BMI hat, allerdings mit länderspezifisch grossen, gar gegenteiligen Wirkungen. Waldmeyer hatte zudem schon früher festgestellt, dass in Ländern mit gut entwickeltem Gastronomie-Level der BMI tief liegt, in Ländern mit gastronomischen Defiziten eher hoch. Das konnte auch Corona nicht ausgleichen. Im Gegenteil: Corona entwickelte sich als Brandbeschleuniger für den BMI-Status: Länder mit mediokrer Gastronomie – oder schlechtem Food-Management wie in Spanien – führten wohl zu einer Erhöhung des BMI-Landesschnitts.
Trump hat ein Problem – Waldmeyer nicht
Während Waldmeyer behutsam etwas weissen Trüffel über die al dente Spaghetti hobelte, dachte er kurz an seinen eigenen BMI. Diesen versuchte er seit längerer Zeit auszublenden. Die inkriminierte Zahl lag bei 25 – also an der oberen Grenze für sein Alter. Ehrlich gemessen lag die Zahl bei 26; aber wenn man die Parameter geschickt einsetzte, eben bei 25. Was ihn allerdings nicht daran hinderte, die BMIs anderer Menschen zu studieren. Ihm fiel auf, dass Donald Trump z.B. – und das wurde von dessen Leibarzt bestätigt – über einen beachtlichen BMI von 30 verfügt. Womit er als „fettleibig“ gilt. Der Superspreader von Fake News kann für einmal jedoch kaum das Gegenteil behaupten: Sein BMI ist nämlich zu sichtbar.
Wie sich die Covid-19-Infektion des amerikanischen Präsidenten wohl auf seinen BMI-Index ausgewirkt hat? Einerseits zehrt eine Krankheit, was einen Gewichtsverlust bewirken könnte. Andererseits könnte sich die Langeweile während der Quarantäne im Weissen Haus, die Bewegungsarmut und die vielen Cheeseburger den BMI befeuert haben. Aber eigentlich war das Waldmeyer ziemlich egal, und er schenkte sich etwas Rotwein nach: Terre Brune, einer seiner Lieblingstropfen.
_______________
11.10.2020
Waldmeyer und der Body Mass Index – Teil 1 (von 3):
Waldmeyer untersucht die Korrelation von BMI und Gastronomie
Und: Die wichtigen makroökonomischen Auswirkungen des BMI aus Sicht Waldmeyers
Der BMI – also der Body Mass Index – hatte Waldmeyer schon immer fasziniert: Mit einer einfachen Formel liess sich die objektive körperliche Erscheinung eines Menschen auf eine einfache Zahl reduzieren. „Schlank“, „korpulent“, „vollschlank“: alles zu ungenau. Mit dem BMI wusste man messergenau, wo man stand. Waldmeyer versuchte nun, einen analytischen Überblick über die aktuelle globale BMI-Situation zu erlangen. Hier der 1. Teil seiner BMI-Trilogie.

Spannende ökonomische Auswirkungen des BMI
Waldmeyer interessierte also die wirtschaftliche Auswirkung der jüngsten BMI-Entwicklungen. Das heisst vor allem der BMI-Steigerungen, welche überall auszumachen sind. Ein höherer BMI in der Bevölkerung kann einerseits makroökonomisch positiv sein, denn es lassen sich grössere Essportionen verkaufen, es braucht mehr Textilien, grössere Badewannen, Betten, grössere SUV, usw. Das Gesundheitswesen profitiert ebenso davon, denn die mit zu hohem BMI einhergehenden Krankheiten produzieren mehr Umsatz an Medikamenten, Operationen, Dienstleistungen. Andererseits kommt es zu Arbeitsausfällen und das staatliche Gesundheitssystem wird belastet, was steigende volkswirtschaftliche Kosten zur Folge hat. Aber: Die Lebenserwartungen werden reduziert, also wird das Rentensystem entlastet. Andererseits muss ein makroökonomischer Verlust verzeichnet werden, da die vorzeitig Verstorbenen ja nichts mehr konsumieren. Positiv wirkt sich wiederum aus, dass die BMI-bedingt früher Verstorbenen auch früher vererben, was sich via grosszügigerem Konsum der Erben und entsprechenden Multiplikator-Effekten gut auf die Wirtschaft auswirkt. Fazit: Schwierig zu sagen, ob die BMI-Entwicklung in der Summe nun letztlich positive oder negative volkswirtschaftliche Auswirkungen produziert. Aus Waldmeyers Sicht lag also keine klare Korrelation zwischen BMI und Entwicklung von Volkswirtschaften vor.
Waldmeyer analysiert weltweit
Auf jeden Fall konnte Waldmeier inzwischen sein Auge dergestalt schärfen, dass er den korrekten BMI bis auf ein, zwei Punkte treffsicher einschätzen kann. Soviel zur Beobachtung seines direkten Umfeldes.
Noch interessanter schien Waldmeyer jedoch eine globale Ausweitung seiner persönlichen BMI-Analyse auf alle Staaten der Welt. Trotz Charlottes Einwänden vertrat Waldmeyer nämlich die Meinung, dass sie künftig nur noch Staaten bereisen sollten, deren BMI auf einem erträglichen Niveau ist. Es sei ja nicht sehr erbauend, wenn sich in den künftig zu bereisenden Ländern nur übergewichtige Leute durch die hübschen Einkaufsstrassen und schönen Boulevards schleppen. Waldmeyer erlaubte sich also die ketzerische Frage, ob es verantwortbar sei, den BMI bei der Auswahl von Reisezielen einzubeziehen.
_______________
Berechne Deinen Body Mass Index! Z.B. mit https://www.amavita.ch/de/bmi
_______________
Charlotte protestiert
Eine gesunde und ausgeglichene Ernährung sei eine Frage des Bildungsstandes, meinte Charlotte, und er solle doch ablassen von diesen erniedrigenden Betrachtungen in Sachen BMI. Aber das mit dem Bildungsstand stimmt eben nur bedingt, denn warum verfügt Deutschland in Europa über den höchsten BMI, die Schweiz über einen der niedrigsten? Studien kamen zum Schluss, dass es wohl „sozioökonomische Faktoren“ seien, welche den BMI eines Landes beeinflussen. Diese Erklärung hilft indessen nicht viel weiter. Es könnten vielleicht auch genetische Faktoren sein, dachte Waldmeyer. Ihm entging es jedoch nicht, dass die Bevölkerung Italiens und Frankreichs über einen sehr tiefen BMI verfügen, übrigens auch Vietnam und Thailand. Portugal, Spanien, Griechenland und Zypern dagegen verzeichnen nur mittlere Werte; das ging nicht nur aus den Statistiken hervor, sondern deckte sich durchaus mit Waldmeyers Beobachtungen an den verschiedenen Strandabschnitten seiner abgereisten Ferienziele. Und dann eben die explodierenden BMIs in den gastronomischen Wüsten, so z.B. in den USA.
Die Welt verfettet
Tatsache ist, dass die Welt zusehends verfettet. Ein Länder-Ranking würde Fürchterliches zutage bringen, selbst bei der Beschränkung dieser Beobachtung auf zivilisierte Länder: Die USA, Neuseeland und Australien liegen weit vorne, sie sind die Adipositas-Anführer. Sie buhlen zusammen mit Kuwait und Katar um die höchsten Werte. Weiter vorne liegen nur noch ein paar pazifische Inseln (Weltmeister sind die Cooks Islands, sowie Samoa mit einem Rekord-BMI von durchschnittlich 50).
Waldmeyer forschte nach den Ursachen der krassen Länderunterschiede und verglich die BMI-Rangliste mit dem Zivilisationsindex – was aber keinen Zusammenhang ergab. Auch das Prokopfeinkommen schien kaum ein massgebender Faktor zu sein, welcher die Essgewohnheiten stringent beeinflusst.
Eindeutige Korrelation zwischen BMI und Gastronomie!
Plötzlich fiel es Waldmeyer wie Schuppen von den Augen: Das gastronomische Niveau, also der Food & Beverage-Level eines spezifischen Landes könnte einen Hinweis auf den BMI der Bevölkerung geben. Heureka! Die Überprüfung seines Ansatzes gab ihm recht. In der Tat gab es eine klare Korrelation: Länder mit einem tiefen F&B Ranking verfügen über einen hohen BMI, Länder mit einem hohen F&B Level haben eine schlankere Bevölkerung.
Oder einfacher ausgedrückt: Wo man schlecht isst, wird man auch dick. Waldmeyer war zufrieden mit seiner Analyse.
_______________
4.10.2020
Max Waldmeyer verkauft Tesla
Sonntagmorgen, Frühstück. Max, Charlotte und – weil Sonntagmorgen – auch die vergeblich erzogenen Kinder Lara und Noa flegeln verschlafen am Tisch rum.
„Ich verkaufe Tesla“, deponierte Waldmeyer etwas platzsprengend. Noa antwortete als erster: „Aber wir haben doch gar keinen Tesla.“ Waldmeyer: „Wir tun so.“

Die Geschichte von Tesla ist bekannt: Der etwas abgefahrene, aber dennoch geniale Elon Musk baut ein ebenso geniales Elektroauto, indem er, leicht vereinfacht, ein Fahrzeug um eine ziemlich gut entwickelte Software mit 2‘000 Handybatterien herumbaut. Die Schlitten verkaufen sich leidlich, aber nicht übermässig. Allerdings: Noch nie konnte ein Geschäftsjahr mit Gewinn abgeschlossen werden. Waldmeyer stellte zudem fest, dass das Tesla betreffende Energieproblem nicht wirklich gelöst ist, denn irgendwo her muss der Strom ja kommen – bei uns in Europa oft aus schmutzigen Braunkohle- oder Atomkraftwerken, ein bisschen noch aus Wind-, Wasser- oder Sonnenenergiekraftwerken. Insgesamt, im Strom-Mix, also nicht sehr sauber. Auch die energiefressende Batterieherstellung ist kein Ausbund an nachhaltiger Ökologie. Aber es war noch nie Elon Musks Anspruch, Energieprobleme zu lösen. Er wollte mehr oder weniger nur ein grosses Handy mit vier Rädern bauen und so nebenbei die Automobilindustrie revolutionieren.
Das elektrische Fahren wird – trotz längerfristig ungelöster Energiefragen – staatlich überall gefördert, und die Automobilindustrie, insbesondere in Europa, wird zu behördlich verordneten Produktionswechseln verdonnert. Tesla liegt technologisch noch zwei, drei Jahre vorne, verkauft seine relativ wenigen Fahrzeuge weltweit. Pro memoria: Tesla-Produktion 2019: 368‘000, VW-Konzern (der weltweit grösste Fahrzeughersteller) über 11 Millionen – also 30-mal mehr.
Waldmeyer dozierte weiter am Frühstückstisch, obwohl eigentlich niemand zuhörte. Aber es ist nun mal ein ganz normaler Vorgang, dass man sich selbst oft lieber zuhört als den andern. Waldmeyer fasste trotzdem weiter laut zusammen und vermerkte, dass Tesla an der Börse zurzeit 380 Milliarden USD schwer ist – das ist fast doppelt so viel, wie die drei grossen deutschen Automobilfirmen zusammen auf die Waage bringen. Der VW-Konzern alleine bringt es auf 77 Milliarden USD – er ist also fünfmal weniger wert als Tesla. Die Ratio Börsenwert/Fahrzeugproduktion stellt sich bei Tesla also bei einem ziemlich unrealistischen Faktor 150 ein, verglichen mit dem VW-Konzern!
Noa klinkte sich nun ein und tippte auf seinem I-Phone rum. Er versuchte, den Börsenwert von Tesla durch die Anzahl Fahrzeuge zu dividieren. Es kamen jedoch nur immer Fehlermeldungen. Zu viele Nullen für das teure Apple-Gerät. Waldmeyer überschlug die Zahlen kurz im Kopf: „Jeder produzierte Tesla entspricht einem Börsenwert von gut einer Million USD“, teilte er dem Frühstückstisch mit. Charlotte war entsetzt: „Wie kann denn einer so blöd sein und einen Tesla für eine Million zu kaufen?“. Waldmeyer rechnete weiter: „Bei VW sieht es anders aus: Börsenwert rund 7‘000 USD pro Fahrzeug.“ Charlotte misstraute den Zahlen. Zumal sie an die Bestellung ihres neuen schwarzen Audis dachte – wohl wissend, dass Audi zum VW-Konzern gehört und dass ihr chices neues Gefährt ein bisschen teurer ausfallen wird.
Die Börse nimmt richtigerweise die Zukunft vorab, und die künftige Performance einer Firma ist dann eben im Kurs „eskomptiert“, wie Waldmeyers Banker jeweils mit gespielter Selbstverständlichkeit zu formulieren pflegte. Nur: Soooo viel Ebit kann eine Firma wie Tesla in den nächsten Jahren unmöglich erwirtschaften, um den Börsenkurs auch nur annähernd zu reflektieren. Herr Musk müsste eine gigantische Tesla-Produktion aufziehen und gleichzeitig ebenso gigantische Gewinne pro Fahrzeug einfahren, um die derzeitige Bewertung zu rechtfertigen. Undenkbar. Aber das heisst nicht, dass die Börse nicht unmögliche Kurse stellen darf – sie darf alles.
„Wenn wir Tesla-Aktien verkaufen würden, machen wir es eh wie Musk“, erklärte Waldmeyer weiter. Für Max war es sonnenklar, dass der gute Elon Werte promotet, die es eigentlich nur virtuell gibt. Fazit: Letztlich bewegt sich die Tesla-Aktie heute auf einem absurd hohen Niveau – trotz den vereinzelten kürzlichen Kurskorrekturen.
Der Trick also: Man spekuliert auf tiefere Kurse, agiert à la baisse. Man kauft Puts. Waldmeyer: „Wir kaufen Rechte, die auf tiefere Kurse setzen. Falls wir dann wirklich recht haben, gewinnen wir, falls nicht, verlieren wir. Wir tun so, als ob wir Tesla-Aktien besitzen und verkaufen sie – virtuell. Weil wir sicher sind, dass sich die hohen Kurse so nicht längerfristig halten können.“
Jetzt kam Lara auf den Plan: „Ist das nicht unethisch, etwas zu verkaufen, das einem gar nicht gehört?“
Nein, reflektierte Waldmeyer. Denn nur so kann Waldmeyer ein Zeichen setzen, wohin der Kurs künftig – realistischerweise – zielen sollte. Vielleicht würde Herr Musk dann kurz konsterniert von seinen Mars-Flugplänen aufblicken, wenn er erfährt, dass Max Waldmeyer, Meisterschwanden, Switzerland, à la baisse verkauft.
_______________
27.09.2020
Waldmeyer, Ludwig II., Merkel und das Internetz
Das deutsche Technologieversagen: Neuschwanstein war nicht elektrifiziert
Waldmeyer war erstaunt: 1886, als der Bau des Schlosses Neuschwanstein des ziemlich irren und verschwenderischen bayrischen Königs Ludwig II. gestoppt wurde, verfügte die prunkvoll geplante Anlage über keine Elektrifizierung. Der erst 40-jährige König fand gleichzeitig mit seiner Absetzung und dem Ende der Bauarbeiten ein unrühmliches Ende in den Tiefen des Starnberger Sees. Prunk, Weltläufigkeit und ein gutes Händchen für die schönen Künste hatten nicht ausgereicht, die teure Anlage auch technologisch up-to-date auszugestalten. Dabei fand die breite industrielle Elektrifizierung in Europa schon ab 1880 statt, Edison lancierte seine Glühlampe bereits 1879, Strassenbahnen verkehrten in Deutschland ab 1881. Das Hotel Kulm in St. Moritz wusste bereits ab 1879 seine Gäste mit elektrischer Beleuchtung zu begeistern. Unternehmer trieben die technologische Revolution im Monatstakt voran, während die Staatsspitzen noch das Bad in der Historie und dem Nichtstun nahmen. Der gute Ludwig hätte übrigens auch auf fliessend Warmwasser verzichten müssen, hätte er je richtig Wohnsitz nehmen dürfen in seiner anachronistischen Bleibe.

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben
Waldmeyer reflektierte, dass dies eigentlich ein ganz normaler systematischer historischer Verlauf darstellte: Bereits Ludwigs Vorfahre Ludwig der I. negierte die technologischen Fortschritte. Mit seinem Ludwig-Donau-Main-Kanal hatte er 1839 zwar eine durchaus visionäre, wenn auch nicht so ausgereifte Idee: eine Schiffsverbindung fast quer durch Europa mit Dutzenden von Schleusen und mit vom Ufer aus mittels Pferdekraft gezogenen Kähnen. Leider eroberte gleichzeitig mit dem schweisstreibenden Kanalaushub die Eisenbahn das Land. Und noch vor der Fertigstellung des Kanalwerks bediente die Bahn ab 1850 (nur drei Jahre nach der ersten Eisenbahn in der Schweiz notabene) alle betroffenen Strecken. Damit war die neue Wasserrinne obsolet. Staatliche Grossmannssucht war eben noch nie ein guter Begleiter des Fortschritts.
Und meinte später nicht der gute alte Gorbatschow: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das geflügelte Wort entstand 1989 in der DDR. Auch 100 Jahre nach Ludwig hatten deutsche Staatsführer offenbar den Zug verpasst.
Wann wird das Allgäu erschlossen?
Waldmeyer sah allerdings ein, dass die historischen technologischen Miseren nicht allein in den Nachbarstaaten zu suchen sind. So bestand z.B. das BAK (das Schweizerische Bundesamt für Krankheit) bis vor kurzem darauf, die Covid-Daten der Kantone per Fax zu erhalten. (Anm. der Redaktion für jüngere Leser oder historisch Interessierte: Ein Faxgerät ist eine analoge Übermittlungsmaschine mit niedrigauflösender schwarz/weiss Qualität, ab 1983 breiter vermarktet – in Deutschland etwas verspätet erst ab 1989 -, seit rund zehn Jahren jedoch fast nirgends mehr in Gebrauch.)
Aber zurück zu Deutschland: Das Land verfügt heute zwar nur über eine bescheidene Gastronomie, indessen über top Industrien. Deren Erzeugnisse sind oft Weltmarktleader. Eine fortschrittliche Nation also?
Bedingt, dachte sich Waldmeyer, als er kürzlich im bezaubernden bayerischen Allgäu ein Wochenende mit Charlotte verbrachte. Wie konnte es nur sein, dass verschiedene Landstriche kaum über eine vernünftige Internetz-Abdeckung verfügten (Anm. der Redaktion: Internetz = deutscher Term für Internet)? Keine NZZ online, kaum WatsApp-Meldungen, das Foto von Charlotte an den Gestaden des Alpsees (Hintergrund selbstredend Neuschwanstein) war nicht zu posten. Das Wetter für den nächsten Tag blieb unbekannt, der Eurokurs auch, die Börsenkurse konnten nur erahnt werden. Der Anhang in der unnützen Email aus der Firma konnte nicht geöffnet werden, hätte aber vielleicht trotzdem wichtig sein können. „Deutschland ist nicht nur eine kulinarische Wüste, sondern auch eine Wüste in Sachen Internet-Abdeckung!“, empörte sich Waldmeyer.
Wir schaffen das…?
Stimmt. Es gibt kaum ein Land ausser Somalia, in welchem es noch dermassen viele Funklöcher gibt, resümierte Waldmeyer. Generell hapert es mit der Digitalisierung an der Basis in Germanien. Die Internet-Abdeckung in den Schulen ist mangelhaft, Schüler und Familien verfügen oft über keine PCs oder Laptops. Das Home-Schooling während der Pandemiekrise geriet deshalb an vielen Orten zum Fiasko. Wir schaffen das…? Mindestens seit zehn Jahren hat sich die deutsche Regierung vorgenommen, hier Abhilfe zu schaffen. Aber sie schafft es nicht.
Zehn Jahre vergeudet…? Die Zahl kennen wir doch: So lange dauert nämlich auch schon die Verspätung des Baus des neuen Berliner Flughafens.
Wenn Mutti nichts tut, macht sie zumindest keine Fehler – eine recht gut funktionierende Strategie, welche übrigens auch der Schweizerische Bundesrat in der Coronakrise gewählt hatte, analysierte Waldmeyer weiter. Nichtstun ist zuweilen in der Tat das Beste, was Politiker tun können, denn nur so werden Pannen vermieden.
Den Staatsführern und Politikern ist allerdings zugute zu halten, dass sich durch Untätigkeit oder aktive Verschleppung die Probleme oft von selber erledigen: Den neuen Flughafen zum Beispiel braucht es gar nicht mehr, weil in absehbarer Zeit kaum mehr geflogen wird.
Waldmeyer for President?
Staaten, bzw. deren Repräsentanten, waren noch nie gute Manager. Vielleicht ist diesbezüglich einzig Singapur eine Ausnahme: Dort werden nur die besten Manager aus der Wirtschaft in Ministerposten gehievt, und sie verdienen marktgerechte Millionensaläre. In den meisten Staaten jedoch herrscht eine Klientel-, Beamten- oder generell eine Misswirtschaft.
Waldmeyer versuchte, seine jüngsten Eindrücke aus dem Allgäu so zusammenzufassen: Staaten werden in der Regel nur in einer Schönwetter-Glocke einigermassen gut verwaltet. Verwaltet, wohl verstanden – nicht geführt, geschweige denn gemanagt. Kommen echte Krisen auf oder stehen nachhaltige Probleme an, versagen diese Setups.
Waldmeyer, als Firmenchef ökonomisch gestählt, meinte zu Charlotte: „Wir brauchen CEOs an der Staatspitze. Die würden den Laden effizienter schmeissen“.
„Max, würdest du dich denn zur Verfügung stellen?“
Nun, das dann doch auch wieder nicht, überlegte sich Waldmeyer.
____________
20.9.2020
Waldmeyers Begegnung mit dem gelebten Islamismus
Waldmeyers hatte seine langjährige Mitarbeiterin Alina Silivič erst kürzlich im Betrieb verabschiedet. Es war ein guter Grund, sich wieder einmal in den Büros zu zeigen. Und Alina hatte es auch verdient, dass Waldmeyer beim Verabschiedungs-Apéro extra ein paar Worte sprach. Sie war eine verdiente Mitarbeiterin, etwas kulturfremd (Kosovo), aber sehr tüchtig. Das war vor einem guten Jahr. Dass sie beim Apéro damals nur Orangensaft trank, war soweit stringent – wohl eben kulturell bedingt. Dass sie im Übrigen kein Schweinefleisch ass, konnte Waldmeyer ebenso nachvollziehen – er mied es selber in der Regel auch. Wie auch den Orangensaft.

„Was macht Alina jetzt wohl?“, fragte sich Waldmeyer laut.
Für einmal antwortete Charlotte. Oft tat sie es nämlich nicht, da Waldmeyer dies gar nicht erwartete (weil er in der Regel mitten in seinem singulären Brainstorming steckte).
„Alina lebt nicht mehr in Hinwil, sondern ist zurück in Pristina. Sie wird wohl weiter keinen Alkohol trinken und kein Schweinefleisch essen. Sie besucht keine Clubs, auf der Strasse ist sie verhüllt, kein Händeschütteln, keine Berührungen und so. Du weisst schon.“ Charlottes Zusammenfassung war aus Waldmeyers Sicht soweit logisch und irgendwie abschliessend – so lebt man nun einmal mit einem islamischen Glauben.
„Glaubst du, sie ist ziemlich orthodox islamisch – oder gar islamistisch? Fundamentalistisch?“, hakte Waldmeyer nach.
„Max, Alina ist Christin. Sie hält sich einfach an die Corona-Regeln. Auch im Kosovo.“
Waldmeyer stutzte. Die Verwechslung war frappant. Corona ist also ähnlich wie der Islam. Könnte es sein, dass Corona nun als Brandbeschleuniger für die Islamisierung in der Schweiz wirkt? Vielleicht wird es an der Zeit, eine neue Verschwörungstheorie zu lancieren: Corona wurde erfunden, um die Islamisierung voranzutreiben. Vermummung, keine öffentlichen Körperkontakte, kein Händeschütteln, keine ausschweifenden Partys, no Clubbing, möglichst kein Alkohol, fertig lustig.
Waldmeyer überlegte sich, wie man die neue Verschwörungstheorie schneller verbreiten könnte. Zumindest in Meisterschwanden. „Charlotte, vielleicht solltest du künftig auf diese blöde Maske verzichten und einen korrekten Niqab tragen“.
_________________
13.9.2020
Max Waldmeyer und sein ethno-epidemiologischer Ansatz
Oder warum die Alhambra der Schlüssel zum Rätsel der zweiten Corona-Welle in Spanien ist

Spanien ist ein Epidemie-Rätsel
Spanien verfügte zu Beginn der Coronakrise den strengsten Lockdown in ganz Europa. Die Einschränkungen zählten, nebst denen in Südafrika, wohl zu den schärfsten weltweit. Trotzdem verzeichnet das schöne Land im Süden in einer zweiten Welle aktuell die höchsten Fallzahlen pro Tag – bis zu 15‘000. Und dies, obwohl die Massnahmen auch heute noch immer einschneidend sind, denn nicht alle Lockdown-Verordnungen wurden gelockert. Zum Teil wurden die Massnahmen wieder verschärft, vor Wochen schon zum Beispiel Clubs wieder geschlossen und Partymeilen aufgelöst. Und doch steht Spanien nun wieder ganz vorne bei den Fallzahlen. Ein Rätsel.
Gibt es eine spanische Virus-Mutation?
Eins war für Waldmeyer klar: Das Virus ist das gleiche. Vielleicht mag es heute ein paar Virus-Mutationen geben – aber kaum eine rein spanische Mutation. Für diesen Ausreisser mussten also andere Gründe vorliegen.
Auch in anderen südlichen Ländern (inklusive Frankreich) und in einzelnen südamerikanischen Ländern steigen die Fallzahlen wieder stark an. Dies, obwohl die Einschränkungen im öffentlichen Leben nach wie vor wesentlich stärker sind als in unseren Ländern – so z.B. in der Schweiz, Deutschland oder Österreich.
Wirklich ein Rätsel. Also versuchte es Waldmeyer mit einer profunden Analyse – so, wie er es damals immer tat, als er noch CEO war. Man musste nur apolitisch sein und die Fakten auseinanderdividieren. Waldmeyer machte sofort vier verschiedene mögliche Gründe für die grossen Länderunterschiede aus:
- Könnte es sein, dass man sich in einzelnen Ländern einfach nicht an die Vorschriften hält? Die Masken eben nur auf hat, wenn man beobachtet wird? Sich trotzdem zu Partys trifft? Also einfach intransigentes Verhalten? Ein Bescheissen von sich selber, der Gesellschaft und des Staates? Gibt es per se klandestine Völker?
- Mit nur Vorschriften allein erreicht man offenbar nichts, denn auch strenge Auflagen können umgangen werden. Die absurden Ausgangssperren in Südafrika, verbunden mit einem Alkohol- und Tabakverbot, waren der Bevölkerung schlecht vermittelbar – also wurden sie nicht eingehalten. Wie das Einhalten des Tempos in gewissen 30-er Zonen, reflektierte Waldmeyer. Die strengen Ausgehverbote in Spanien waren ebenso schwer verständlich. Wieso sollte man nicht im Freien oder einfach am Strand spazieren dürfen? Ein Lockdown in Franco-Manier mit der martialischen Guardia Civil auf der Strasse kommt bei der Bevölkerung nicht gut an. Wenn der Bürger sich auf Druck nur vernünftig verhalten soll, geht der Schuss oft hinten hinaus. Liegt der Grund der neuen Epidemie-Misere in Spanien also im mangelnden Verständnis und Überzeugung in der Bevölkerung? Nur mit diktatorischem Verhalten lässt sich das Volk nicht gewinnen.
„Wir müssen zusammenstehen“, meinte doch Frau Sommaruga. Und die ausgebildete Pianistin meinte dies wirklich ehrlich. So wie das Fingerspiel auf dem Klavier müsste es sein: ein perfektes Zusammenspiel von allen Bürgern, mit dem Ziel, das Ziel auch zu erreichen. Vielleicht hatte der Aufruf bei uns tatsächlich genützt?
In gewissen anderen Ländern wurden in der Tat nur strenge Dekrete verhängt, mit drakonischen Strafen – ohne intelligente PR-Leistung. Man hatte sich nicht darum gekümmert, Überzeugung zu erzielen. Könnte dies ein Grund sein für das falsche Verhalten in der Bevölkerung? Ein Regierungsversagen? Hätte eine Klavierspielerin in Spanien das Ruder herumreissen können?
- Oder könnte es auch der Bildungsstand sein? Vielleicht begreift ein Teil der Bevölkerung einfach nicht, wie man einer Pandemie tatsächlich begegnen muss? Dieses ablehnende Verhalten lässt sich in Teilen sogar in unseren Staaten ausmachen. Verschwörungstheorien tragen das Ihre dazu bei, denn sie erreichen oft Leute mit geringem Bildungsstand – entsprechend fällt ihr pandemisches Benehmen aus. Also: Je geringer der Bildungsstand, desto weniger hält sich die Bevölkerung an Vorgaben und Empfehlungen?
- Könnte es sein, dass es das Sozialverhalten eines Volkes ist? Fiesta, Partys, lautes Feiern. Dazu das Wohnen mit mehreren Generationen in engen Räumen. Und das immerfort laute Sprechen, das nahe Beieinanderstehen. Also ein ethno-epidemiologischer Ansatz?
Waldmeyers Synthese nun:
Er gewichtete den Grund Nummer 4 (ethnisch basiertes Sozialverhalten) mit 10 Punkten, Nummer 3 (Bildungsstand) mit 3 Punkten, Nummer 2 (Regierungsversagen) mit 2 Punkten und den Grund Nummer 1 (intransigentes Verhalten) ohne Punkt – denn dieser Grund ist quasi schon aufgegangen im Grund 2 und 3.
Analyse und Synthese sind manchmal ganz einfach, dachte sich Waldmeyer, als er weiter bei Netflix rumzappte und sich Cognac nachschenkte. Man müsste also eine neue Wissenschaft begründen: etwa die der Sozioepidemiologie? Sozialepidemiologie gab es übrigens schon. Diese Disziplin half Waldmeyer jedoch nicht weiter, denn sie konzentrierte sich auf soziale Parameter (wie Geschlecht, Alter, Einkommen, etc.), die auf das epidemische Geschehen einwirken. Die neue Sozioepidemiologie würde das Problemfeld eher abdecken, sie könnte untersuchen, wie sich eine Epidemie aufgrund des sozialen Verhaltens ausbreitet. Die Disziplin müsste jedoch mit einer ethnischen Betrachtung erweitert werden, denn das soziale Verhalten allein greift zu kurz. Also dann besser gleich Ethno-Epidemiologie, da wäre das soziale Gebaren quasi schon drin.
Nur nicht Charlotte einbeziehen
Charlotte würde Waldmeyer umgehend fragen, was seine neue Disziplin denn bringen sollte. Sie würde ihm wohl sogleich darlegen, dass aufgrund gewonnener Erkenntnisse dieser neuen Wissenschaft die Spanier trotzdem nahe beieinander stehen und sich selbst Beiläufiges ins Gesicht brüllen würden. Also unterliess es Waldmeyer, Charlotte hier einzubeziehen.
Auch arabische Völker neigen übrigens zu dieser Unart des laut Sprechens und des zu nahen Körperkontakts. Um die Ausbreitung einer Epidemie zu verzögern, müsste man also das Sozialverhalten eines Landes – oder einer ganzen Ethnie eben – ändern.
Ethno-Epidemiologie: ein Minenfeld
Waldmeyer war ziemlich überzeugt, dass er mit seinem neuen wissenschaftlichen Ansatz richtig lag. Vor allem der Link Spanien-Arabien erschien ihm als hoch-interessant: Hatten nicht die Mauren einst Spanien fest im Griff? Die Alhambra in Granada zeugt noch heute davon.
„Heureka, jetzt haben wir’s“, meinte Waldmeyer zu Charlotte: „Die Spanier sind eigentlich Araber und verhalten sich ethno-epidemiologisch problematisch. Da helfen auch keine Lockdowns, die müssen das durchstehen.“
Charlotte antwortete nicht. Soll sich Max doch alleine in dieses ethnische Minenfeld begeben; sie blieb da aussen vor. Aber vermutlich hatte er recht.
______________
6.9.2020

Waldmeyer bei Bergbauer Ruedi Arnold
Unser Landwirtschaft kostet Unsummen
Waldmeyer entschied sich, das letzte Stück zu Fuss zurückzulegen. Immerhin hatte er es mit seinem Porsche Cayenne (schwarz, innen auch) bis zur letzten Kehre geschafft. Der Fussmarsch in den schwarzen Sneakers war also zumutbar. Im Rucksack befanden sich zwei gekühlte Flaschen Bier. Waldmeyer hatte sich während den Tagen zuvor einige Gedanken über die Schweizer Landwirtschaft gemacht. Avenir Suisse hatte kürzlich berechnet, dass uns diese 21 Milliarden pro Jahr kostet. Eine Unsumme also, die sich auf 200‘000 Franken pro Beschäftigten in der Landwirtschaft verteilt. Ein guter Grund also, die Sache mit Ruedi zu besprechen, seinem alten Schulfreund. Dieser hatte sich vor einiger Zeit zurückgezogen und lebt nun als Bergbauer in der Innerschweiz. Ruedi Arnold hatte nämlich schon immer brillante Ideen.
Subaru, Samsung, Dyson
„Die sind ja warm“, meinte Ruedi, als er den verschwitzten Waldmeyer begrüsste und die beiden Feldschlösschen aus dem Rucksack zog. Er stellte sie zu den anderen Feldschlösschen in das neue Samsung Foodcenter. „Und wieso bist du nicht ganz raufgefahren?“ Ruedi deutete auf seinen blitzblanken neuen Subaru vor der kürzlich errichteten, vollklimatisierten Scheune. Elias (aus Eritrea) reinigte gerade den Innenraum des neuen Gefährts – mit einem neuen Dyson.
Waldmeyer hatte den Ort noch als abgeschiedenes Idyll in Erinnerung und war etwas enttäuscht. Vor gut 10 Jahren, als Ruedi sich als Aussteiger outete und sich auf die Alp verzog, war alles noch ziemlich einfach. Inzwischen schien sich Bergbauer Arnold mit Hilfe der staatlichen Unterstützungen recht gut organisiert zu haben.
Vom Fensterbauer zum Bergbauer
Ruedi Arnolds Werdegang war schon immer etwas anders. Erst der Schulabbruch, dann die Lehre als Baufensterschreiner. Dann kamen die starken Mehrfachverglasungen, die Fenster gingen nicht mehr kaputt, denn diese hielten plötzlich allen Fussbällen und anderen Geschossen stand. Der örtliche Fensterschreiner musste seine Waffen strecken und Ruedi wurde arbeitslos – dann aber Futtermittelverkäufer (Aussendienst). Umtriebig genug, stieg er jedoch bald in den Occasionshandel ein, später kamen die Neuwagen dazu. Auch dies war ihm indessen bald zu repetitiv, und er setzte auf die Börse – massiv. Bis Lehmann Brothers. Ab 2009 dann wieder Futtermittelverkäufer, allerdings digital. Und dann die Alp.
Waldmeyer warf einen Blick in die Küche. Die multi-taskende Paula sprach in Portugiesisch wie ein Maschinengewehr in ihr iPhone 11 plus, blätterte gleichzeitig in einer Modezeitschrift, kraulte eine Katze und warf Waldmeyer ihr bezauberndes brasilianisches Lachen zu. Von zwei PCs flimmerten Notierungen mit Futtermittelpreisen, und es roch nach frischem Apfelkuchen. Alles stimmte.
2‘500 Franken pro Bürger
Das Gespräch mit Ruedi auf der Veranda war sehr erbauend. Nach dem dritten Bier waren sie sich ziemlich einig: Eigentlich sind diese staatlichen Unterstützungen für die Landwirtschaft absurd. Diese Geldvernichtungsmaschine produziert Outputs, welche nur einem Bruchteil der Inputs entsprechen. Und Ruedi wusste: Fast alle Futtermittel werden importiert – das mit der gesicherten Landesversorgung war also eh eine Illusion. 21 Milliarden dividiert durch 8.5 Millionen Einwohner, so rechnete Ruedi vor, ergeben rund 2‘500 Franken pro Jahr: So viel kostet die Landwirtschaft pro Kopf und pro Jahr. Ob das der Bürger wirklich so möchte?
Lotti auf die Wiese für 1‘500 Franken
Ruedi schlug also vor, sämtliche Importzölle und Subventionen abzuschaffen. An deren Stelle würde er einfach hundert Franken jährlich pro Hektare für die Landschaftspflege erhalten. Die Touristen schätzen in der Tat akkurat geschnittenen Wiesen, gepflegte Wege und Wälder. Er würde nur eine einzige Kuh behalten, diese am Wochenende rausstellen (1‘500 pro Jahr). Lotti als Schmuck quasi, wie die saubere Fassade seiner inzwischen ziemlich grossen Alphütte. Lottis Milch würde der kleinen Käseproduktion dienen, Paula würde sich darum kümmern. Die Tomme Paula brächten fünf Franken pro Stück, Direktverkauf ohne Quittung an die Touristen – und ohne einen Rappen Subvention. Oder direkt an die Migros, mit vollem Merchandising-Service direkt ins Regal geliefert. Lotti könnte pro Jahr 9‘000 Liter hochwertige Biomilch produzieren, davon lassen sich 4‘630 Tommes herstellen!
Viermal Alphorn blasen wöchentlich (während der Wandersaison) gibt nochmals 100 Franken pro Monat. Alles im Punktesystem am besten, das ist einfach; die Leistungen könnten zudem ebenso einfach überprüft werden. Das Alphorn zum Beispiel hört man bis ins Unterland. Im Winter dann könnte er Futtermittel traden. Das mit den Skiliften sei jetzt eh vorbei.
Siedlungen statt Felder?
Erleichtert trat Waldmeyer den Abstieg ins Tal an – oder besser die Hinunterfahrt. Ruedi hatte recht: Landschaftsgärtner wären viel günstiger. Und mit dem neuen Ansatz wären die importierten Lebensmittel auch günstiger. Beim Hofbauern in Meisterschwanden könnte Waldmeyer immer noch das Biogemüse holen, wenn auch erheblich teurer. Aber was sollte man mit den Raps- und Maisfeldern machen im Unterland, die dann nicht mehr gebraucht würden? Vielleicht Siedlungen? Eine neue Stadt, ein grosser Wurf? Waldmeyer nahm sich vor, Ruedi bald wieder zu besuchen.
_________________
30.8.2020
Waldmeyer und die Verschwörungstheorien
Oder warum Marylin Monroe in Wahrheit ermordet wurde

Freddy Honegger ist suspekt
Waldmeyer fand seinen Nachbarn Freddy Honegger schon immer komisch. Als dieser kürzlich wieder über den Gartenzaun hinweg ein Gespräch beginnen wollte („stimmt es eigentlich, dass Obama ein Moslem ist?“), überlegte Waldmeyer kurz, ob er mit der Bemerkung kontern sollte, dass der Papst vermutlich ein Freimaurer sei.
Freddy Honegger war ihm einfach suspekt. Vor allem seit er über seinen Rotary-Kanal zu hören bekam, dass Freddy in seiner Jugend bei den Zeugen Jehovas war – wo er auch seine Frau Bettina kennengelernt hatte.
In der Folge hatte sich Waldmeyer sofort à fonds in die Causa Zeugen Jehovas eingelesen. Jesus war also am Pfahl und nicht am Kreuz gestorben. Das war ein Unterschied. Die Zeugen Jehovas lehnen Bluttransfusionen ab, kennen strenge Kleidervorschriften, müssen missionieren und dürfen keinen Militärdienst leisten. Jetzt war auch klar, warum Freddy nie in den WK musste. Und es gibt in der Schweiz 19‘000 Mitglieder in diesem Club. Freddy zählte heute nicht mehr dazu; geblieben war ihm allerdings das Missionarische. Und jetzt kamen eben diese Verschwörungstheorien hinzu. Aber noch viel schlimmer war seine Frau Bettina: eine überzeugte Impfgegnerin, psychopathisch-ängstlich und zu allem noch eine ebenso überzeugte Veganerin. Ihr musste man am Gartenzaun besonders ausweichen.
Heute auf jeden Fall fühlte sich Waldmeyer nicht motiviert, mit Honeggers über Verschwörungstheorien zu debattieren. Also supponierte er einen plötzlichen und dringenden Telefonanruf. Er wollte auf eine raffiniertere Gelegenheit warten, um dieses Gespräch wieder aufzunehmen. Doch dazu später.
Immer mehr Verschwörungstheorien?
Waldmeyer fiel auf, dass sich in letzter Zeit die Verschwörungstheorien häuften. Diese standen meistens in Zusammenhang mit dem Corona-Virus.
Hinter der ganzen Pandemie-Misere versteckte sich offenbar Bill Gates. Ziel ist natürlich der Impfzwang, denn Bill Gates steckt unter einer Decke mit den grossen Pharmafirmen. Dieser ganze Corona-Hype war also nur vorgeschoben. Die Impfstoffe werden übrigens aus abgetriebenen Föten hergestellt, und gleichauf mit den Impfungen wird man „gechipt“ (Anm. Redaktion: ein Chip eingesetzt) – der Staat perfektioniert die Kontrolle. George Orwell wäre also, in elektronisch verbesserter Form, auch in Meisterschwanden oder im Allgäu angekommen. Letztlich geht es dabei nicht nur um die Verhaltenskontrolle der Bürger, sondern generell um die Kontrolle der Bevölkerungszahl auf der Erde. Bill Gates wird unterschätzt. Und die Lockdowns wurden nur orchestriert, um demokratische Bürgerrechte auszusetzen, ganz klar.
5G ist übrigens, um das Big Picture zu erweitern, auch eine Ursache von Covid-19. Und israelische Juden töten gefangene Palästinenser, um einen schwunghaften Organhandel zu betreiben. A propos Handel: Hillary Clinton betrieb vor ein paar Jahren einen Kinderpornohandel, getarnt in einer Pizzeria.
Natürlich wusste Waldmeyer, dass insbesondere bildungsarme Bevölkerungsschichten und oft Vertreter des ultra-rechten Lagers gerne Verschwörungstheorien pflegen. Immerhin zeigen sich gemäss einer Untersuchung 25% der Deutschen dafür anfällig, insbesondere in den neuen Bundesländern. Venezolaner sind auch sehr empfänglich für abstruse Theorien: Hugo Chavez produzierte einige davon, u.a. die brandaktuelle Gefahr einer amerikanischen Invasion. In der Folge liess er die komplette Bevölkerung in allen Favelas bewaffnen. Die Armen verdankten es ihm mit hoher Gefolgschaft.
Wir müssen jedoch geografisch gar nicht so weit suchen: George Soros mit seinen Schulen und Universitäten plant nämlich einen Umsturz in Ungarn. Ein perfektes neues Feindbild für Viktor Orban, um von allerlei Problemen abzulenken und demokratische Rechte auszuhebeln.
War die Mondlandung gefaked?
Und geografisch noch näher: Auch Waldmeyers Haushalt war nicht ganz gefeit vor Verschwörungstheorien. Charlotte zum Beispiel vertrat die Meinung, dass die Mondlandung gefaked wurde. Diese Bilder von den Astronauten seien einfach zu scharf, Stars and Stripes flattern nicht im Wind: ergo muss es eine Studioaufnahme sein. Waldmeyer liess ihr diese Geschichte (sie kam mindestens einmal jährlich) jeweils durchgehen. Diesen Samstag jedoch, als die Mondlandung wieder fällig war, rächte er sich ein bisschen mit einer eigenen Theorie: Er meinte, Bettina Honegger, also die Nachbarin, sei eine späte Tochter dieser DDR-Hexe Margot Honegger. „Die schrieb sich mit ck, Schatz!“, konterte Charlotte. Waldmeyer überlegte noch kurz, ob er Bettina Honegger alternativ als jihadistische Schläferin positionieren sollte. Dieses Missionarische deutete eindeutig darauf hin, vielleichte bereitete sie sich nur auf einen terroristischen Messereinsatz vor? Er liess es bleiben.
Fake News oder Verschwörungstheorien?
Zwischen Fake News und Verschwörungstheorien verläuft ein schmaler Grat. Donald Trump Junior z.B wirft Joe Biden Pädophilie vor. Ein Grenzfall. Donald Trump Senior beschuldigt die Gesundheitsbehörden, die Medien und die Demokraten, das Corona-Virus erfunden zu haben, und natürlich beschuldigt er auch China („the China virus“). Fake News oder Verschwörung?
Donald Trump dürfen wir auch zugute halten, dass er die „alternative facts“ erfunden hat. Deshalb war Corona erst mal nur eine Erfindung, nur eine kleine Grippe. Der amerikanische Präsident bricht so oder so einige Rekorde in Sachen Fake News oder Verschwörungstheorien. An den gewalttätigen Demonstrationen in vielen US Städten sind z.B. die Demokraten schuld. Insbesondere sein Widersacher Joe Biden.
Verschwörungstheorien und Fake News liegen also eng beieinander: War der erneute Covid-19-Ausbruch in Peking nun auf diesen Lachs zurückzuführen – oder doch auf dieses infizierte Schneidebrett mit dem verdächtigen Lachs? Oder wurde zuvor das Virus durch den US-Geheimdienst in Wuhan losgelassen? Oder entwich es unglücklicherweise doch in diesem chinesischen Labor?
Verschwörungstheorien sind vielleicht einfach Fake News, dachte sich Waldmeyer, welche höhere Weihen erhalten haben, mit Konzept und Steuerung? So musste es wohl sein.
Es gibt immer mehr Raser – der Verkehr wird immer gefährlicher
2019 zählte die Schweiz 187 Verkehrstote. 1970 waren es noch 1773 – also fast 10-mal mehr. Im gleichen Zeitraum hatte sich der Bestand an Motorfahrzeugen mehr als verdreifacht. Damit hat sich das Risiko, heute in einem Verkehrsunfall zu sterben, um das Dreissigfache verringert.
„Ein Wunder, dass wir damals 1970 nicht gestorben sind“, meinte Waldmeyer, als er von seinen Statistiken aufblickte. „Max, 1970 war ich ein Kleinkind und kerngesund. Was meinst du genau?“ „Es geht um den Verkehr, Charlotte.“ Charlotte verstand nicht: „Aber das war doch 9 Monate davor?!“
Waldmeyer seufzte. So wie er offenbar missverstanden wurde, wird auch vieles andere auf der Welt missinterpretiert. Nur: Leider hat das oft System.
Was den Verkehr anbelangt, so wird heute oft behauptet, dass dieser verrohe und gefährlicher geworden sei. Doch warum nur? Die Zahlen sprechen dagegen. Das spielt jedoch keine Rolle, wenn ein Statement mit Inbrunst vorgetragen und eine Message unablässig gepflegt wird.
Selektive News sind de facto auch Fake News
Mitten im Lockdown ereilte die Schweizer Medien die Message, dass die Eidgenossen offenbar deutlich mehr Gemüse essen. Hatte also ein Umdenken eingesetzt, eine pandemische Läuterung sozusagen? In der Tat waren die Verkaufsumsätze in den Supermärkten deutlich in die Höhe geschnellt. Aber kein Wunder: Der grenznahe Einkauf war unterbunden, die Restaurants geschlossen, also wurde zuhause mehr gekocht – und deshalb mehr eingekauft, auch mehr Gemüse. Fehlinterpretationen oder selektive Informationen führen oft zu Fake News.
Die USA seien am meisten von der Pandemie betroffen – das verkünden die Medien fast täglich. Falsch. Richtig ist nur, dass die USA numerisch die meisten Fälle aufweisen. Aber das kleine Belgien mit nur 10 Millionen Einwohner verzeichnet bis heute 10‘000 Corona-Tote. Verhältnismässig gesehen also Weltrekord. Die korrekte Aussage wäre also, dass Belgien am meisten von der Pandemie betroffen ist. Waldmeyer hatte diese Information allerdings noch nie erhalten. Überhaupt, was ist mit Belgien? „Brussels is a nice country“, meinte Trump doch kürzlich – aber das waren wohl, für einmal, ungewollte und auf peinlichem Unwissen basierende Fake News.
Herausgepickte News eignen sich auf jeden Fall hervorragend für Missinterpretationen. Und richtig aufgebaut, können sie gar das Potential für eine raffinierte Verschwörungstheorie bilden.
Verschwörungstheorien: viel Unappetitliches und viel Amüsantes
Wir ahnten es schon: 9/11 war nur ein CIA-Einsatz. Die CIA war auch für den Tod von Martin Luther King verantwortlich. Dem gleichen Geheimdienst wird angelastet, den Tod JF Kennedys inszeniert zu haben, auch das rasche Ableben Marilyn Monroes – das entsprach nur der Logik, hatte die gute Marilyn doch ein Verhältnis mit JFK. Dass aus ähnlichen Gründen Lady Di durch den MI6 ins Jenseits befördert wurde, macht damit ebenso Sinn.
Geschmackloser ist allerdings die Theorie, wonach der Holocaust eine Erfindung der Juden sei, um diesen eine raffinierte und ewige Opferrolle zu verleihen. Generell streben die Juden übrigens die Weltherrschaft an. Allerdings auch die Freimaurer.
Schon 2012 entwickelte Donald Trump die breit in den Umlauf gesetzte Theorie, dass die Klimaerwärmung nur eine Erfindung der Chinesen sei, um der Entwicklung der US Industrie zu schaden. Ja, der alte Trump kann auf eine beachtliche Zahl von portierten Verschwörungstheorien zurückblicken, vermutlich gebührt ihm sogar der erste Rang in dieser Disziplin! Immerhin in einer.
Obama wurde übrigens gar nicht in den USA geboren, und Hitler überlebte in Argentinien. Paul McCartney ist eigentlich tot und wurde durch einen Doppelgänger ersetzt.
Man sollte mehr eigene Theorien entwickeln, dachte sich Waldmeyer.
Zurück zu Honeggers:
Am Sonntagmorgen früh fing die vegane Bettina Honegger den noch etwas schläfrigen Waldmeyer kurzerhand vor der Garage ab. „Max, es ist unglaublich: Offenbar war es George Soros, der in China dieses Covid-19 inszeniert hatte!“ Auf einen solchen Moment hatte Waldmeyer nur gewartet. „Ja, das kann gut sein“, antwortete er lakonisch. „Wusstest du übrigens, dass auf dem Gelände eures Hauses bis in die 70-er Jahre ein Schlachthof stand…?“
_______________________
23.08.2020
Waldmeyers Tipp, wie man sich raschmöglichst mit Corona anstecken kann
Eigentlich hätte die Grillparty bei Waldmeyers in Meisterschwanden ganz normal verlaufen sollen. Sondereggers waren eingeladen. Sie waren froh, aus den abgebrochenen Ferien zurück zu sein und einen ruhigen Abend unter Freunden zu verbringen. Aber wie immer endete der Abend in unkontrollierten Gesprächen.

Die Costa Corona war ein Fiasko
Erst fasste Reto Sonderegger nochmals kurz – bzw. sehr ausführlich – seinen missglückten Italien-Urlaub zusammen („Anm. der Redaktion: siehe Waldmeyers Glosse „Costa Corona“ vom Mai 2020). Sondereggers waren wohl zu früh in Italien, ganz am Anfang nach dem Lockdown. Reto rapportierte nochmals seine erfahrene Unbill: die Maskenpflicht bis zum Strand runter, das Lichtsignal zum Betreten des Strandes, die strengen Carabinieri, die Plastikabschrankungen um die Liegen, die eingeschweissten Badetücher, die eingeschweissten ungeniessbaren Sandwiches, den kurzen Slot zum Schwimmen, den noch kürzeren Slot um 11:30 für den ungeniessbaren Lunch, den vorzeitigen Ferienabbruch. Ein Fiasko. Schön, jetzt in Frieden bei Waldmeyers im Garten zu grillieren.
Nur nicht in einem südlichen Land im Korridor eines Landspitals einsam sterben
„Max, ich habe es satt, immer mit dieser Angst zu leben, angesteckt zu werden. Und dann womöglich in einem südlichen Land in einem Korridor eines Landspitals alleine zu sterben. Ich möchte jetzt kontrolliert Corona durchstehen, dann immun und frei sein.“
Eigentlich hatte Sonderegger recht: Es wird demnächst keine Impfung geben. Eine Impfung ist jedoch nichts anderes als eine kontrollierte Immunisierungsansteckung. Also liegt der Schluss nahe, dass man sich – kontrolliert und überwacht – vorsätzlich anstecken sollte. Damit umgeht man eine unkontrollierte Ansteckung an einem fremden Ort, mit allenfalls viel Ungemach.
Waldmeier zog die Plastikhandschuhe aus (welche sich zum Grillieren nicht wirklich eignen), lüftete seine Maske etwas und zwang Sondereger zu einem Brainstorming: „Ok, du möchtest dich also raschmöglichst anstecken.“
Nur kurz Corona inhalieren
Waldmeyer resümierte kurz: Ja, das wäre eigentlich ein guter Plan. Hier in der sicheren Schweiz kurz Corona inhalieren, schlimmstenfalls grippeähnlich diesen Covid-Dreck durchstehen und dann Ruhe haben. „Ok, wir brauchen also einen Plan.“
Im Anschluss darauf folgte das relativ breit gefasste Brainstorming. Gleich zum Vornherein, inspiriert von Donald Trump, fiel die Variante mit irgendeiner Injektion weg. Auch die Ansteckungsvariante mittels dem Lösen einer Tageskarte für das Zürcher Tram – die wohl günstigste Ansteckungsmethode – entfiel, nachdem nun die Maskenpflicht im ÖV eingeführt wurde.
Der Vorschlag von Waldmeyer, in einem Kirchenchor zu singen, wurde ebenso verworfen (Sonderegger: „Ich kann nicht singen, zu auffällig.“) Alternativ ein Konzert oder einen Fussballmatch mit johlenden Fans zu besuchen, konnte aus bekannten Gründen auch kein realistischer Plan sein – es gab einfach keine praktischen Anlässe zurzeit. Immerhin boten sich die Corona-Partys der Jugendlichen an. „Auch zu auffällig, die nehmen mich alten Sack da nicht rein.“
Als Erntepflücker anheuern?
Die beiden mussten also, mittels Ausschlussprinzip, weitersuchen. Waldmeyer, betriebswirtschaftlich gestählt und bereits angenehm alkoholisiert durch den schweren Wein aus Sardinien (der hervorragend zum Ribeye passte), betrachtete die Übung als makroökonomische Herausforderung. In der Not lancierte Waldmeyer nun die Idee, in einem fleischverarbeitenden Betrieb anzuheuern, so zum Beispiel bei Tönnies. „Da komm ich nicht rein, ich spreche kein Rumänisch. Und als Erntepflücker habe ich auch keine Chance mit meinen Bürohänden.“
„Kennst du viele Heuschnupfer?“, meinte Max. Die Idee dahinter: Tröpfchen erreichen beim Niesen Geschwindigkeiten von über 250 km/h, bei Husten nur einen Bruchteil davon. Man müsste sich also nur unter Heuschnupfer mischen. Selbstredend möglichst unter infizierte Heuschnupfer. Doch wie findet man die?
Natürlich könnte man einfach nach Spanien reisen und dort ein Bad in der Menge nehmen. Die Spanier sprechen ja bekanntlich überaus laut – und mit absolut minimalen Distanzen zueinander. Wenn man die lokale Kommunikation konsequent pflegen würde, könnte es einen guten Treffer geben. „Ich spreche aber kein Spanisch“, meinte Sonderegger verzweifelt. Allerdings müsste Sonderegger gar nicht sprechen. Eine Diskothek in Barcelona würde reichen, um eine hohe Ansteckungschance zu erreichen. Zwar empfehlen die spanischen Behörden, aus Sicherheitsgründen um die Tische herum zu tanzen, damit die Distanzen eingehalten werden (Masken sind nicht Vorschrift). Sonderegger würde diese brillante Anweisung nicht einhalten und sich unauffällig unter das junge Partyvolk mischen. „Ich möchte aber gar nicht nach Spanien runter“. „Du bist schon sehr wählerisch, Reto“.
Auf nach Spreitenbach
Nun war es an der Zeit, den offensichtlichsten Tipp Waldmeyers zu besprechen: „Geh nach Spreitenbach“, schlug Max vor. „Du musst nicht einmal einen Serben kennen, geh einfach in diesen Shisha-Club.“
„Der Türsteher lässt Leute über 50 aber nicht rein“, warf Sonderegger ein.
Waldmeyer seufzte, legte nochmals ein Steak auf die Kohle und entkorkte den dritten Terre Brune mit dem Kommentar: „Sardinien.“
„Ich soll nach Sardinien…?“ „Nein, Reto, du musst nicht nach Sardinien. Aber ich habe die Lösung!“
Der BAK-Tipp: Das Gute liegt so nah
Gute Lösungen sind manchmal die naheliegendsten und die einfachsten. Waldmeyer hatte also eine bestechende Eingebung und skizzierte den folgenden Plan: Da hatte doch das BAK (Bundesamt für Krankheit) kürzlich seine Zahlen korrigiert und messerscharf analysiert, dass sich die meisten Ansteckungen im Familienbereich ereignen sollen. Das Corona-Virus entwickelt sich offenbar, laut BAK, von selbst innerhalb eines Haushalts. Ergo könnte man sich am besten gleich in der Familie anstecken.
„Reto, du musst einfach in die Quarantäne – zuhause. So hast du rein statistisch, gemäss BAK, die beste Chance, dich rasch anzustecken. Geh einfach zehn Tage nicht raus und warte. Wenn das Virus nicht zu dir kommt, warte nochmals zehn Tage.“
Sonderegger fiel natürlich nicht auf den Trick rein. Die Geschichte vom Samichlaus, der durch das Cheminée das Virus in die Hütte bringt, hatte er natürlich schon gehört. Der Samichlaus war nämlich vorher in diesem Club in Spreitenbach.
Die Putzfrau ist die Lösung
Plötzlich erinnerte sich Sonderegger daran, dass seine Putzfrau aus dem Kosovo kommt und in 11 verschiedenen Haushalten tätig ist. „Max, vielleicht hatte ich dieses Corona bereits!“ Waldmeyer rettete instinktiv sein Glas Terre Brune und rückte vom Tisch weg.
Nachdem sich Waldmeyer beruhigt hatte, beschlossen die beiden, ihr Brainstorming zu beenden. Es war eh schon spät geworden. Sie einigten sich darauf, dass Sondereggers Kosovo-Variante die beste wäre. Waldmeyer murmelte mit schwerer Zunge noch etwas von einem konjunktiven Opportunitätsgewinn: „Man hätte es bereits gehabt haben können.“ Mit Abstand die eleganteste Lösung. Damit entfiel auch das Horror-Szenario mit dem Spitalkorridor in Italien.
____________
16.08.2020
Waldmeyer und die Mohren
Waldmeyer hatte seit Wochen keinen Schwarzen mehr gesehen
Waldmeyer interessierte sich bis anhin kaum für die Frage der Schwarzen, ihrer Rechte, die ganze Misere in den USA. Es war einfach zu weit weg, und er konnte es nicht ergründen, warum wir nun plötzlich auch ein Problem in der Schweiz haben sollten.

Waldmeyer hatte seit Wochen keinen Schwarzen mehr gesehen – ausser auf Netflix natürlich. Und ausser Elias, den Eritreer, der bei seinem Schulfreund Ruedi Arnold auf der Alp arbeitet. Elias war aber eigentlich auch kein echter Schwarzer. Waldmeyer würde seinen Teint etwa als „70-%-pigmentiert“ definieren – fast so wie bei Obama. Waldmeyer war stolz auf seine akkurate Bezeichnung – vor allem, weil unser Wortschatz einfach nichts Treffendes parat hatte für Elias. Es gab da zwar noch diese Bezeichnung „Mulatte“. Diese war indessen auch nicht genug zutreffend, und Waldmeyer war unsicher, ob der Begriff überhaupt erlaubt ist. Franzosen sprechen in diesen Fällen häufig von „café au lait“ – was in der Tat gar nicht negativ besetzt oder rassistisch ist. Aber wie erwähnt: Waldmeyer sah bisher wenig Zusammenhang zwischen diesen Themen und unserem gesellschaftlichen Leben in der Schweiz.
Interessant wurde diese Angelegenheit erst jetzt: Da wurde nämlich plötzlich dieses „Café zum Mohrenkopf“ in Zürich unbenannt, die U-Bahnstation „Mohrenstrasse“ in Berlin ebenso, die „Colonial Bar“ in Bern hiess nun, etwas verloren, plötzlich „Bar“. Und dann kam noch die lächerliche Mohrenkopfgeschichte hinzu. Nicht genug: Die „Zigeunerschnitzel“ wurden flächendeckend von den Speisekarten genommen, und die Firma „Schwarzkopf“ tüftelte nun offenbar an einer Namens- und Logänderung. Ob der Begriff „Pfadilager“ wohl noch geht? Abgesehen von dem konnotierten Begriff „Lager“ kam nun erschwerend hinzu, dass Lord Baden-Powell (der Gründer der Bewegung) offenbar ziemlich rassistisch eingestellt war.
BLM – British Leyland Motors
Am Samstagmorgen fragte Waldmeyer seine Tochter: „Lara, was läuft heute?“ Er vermied es, die Frage „was machst du heute?“ zu formulieren, was nie gut ankam. „Was läuft heute“ klang unverbindlicher, kontroll-armer, partizipativer.
„BLM“, erklärte Lara (23).
„Toll, ich war schon lange nicht mehr in Mürren.“
„Hää? Wir treffen uns in Zürich!“ Es brauchte einige Zeit, bis das Missverständnis betreffend Black Lives Matter und den Bergbahnen Lauterbrunnen-Mürren aufgeklärt war. Waldmeyer kam auch noch British Leyland Motors in den Sinn, was Lara natürlich nicht mehr kannte – ein Punkt für ihn.
Waldmeyer überlegte kurz, dass Lara an der Demo nun eine Maske tragen müsste, in Mürren jedoch keine – unterliess aus erziehungstaktischen Gründen aber die Bemerkung. Er rief seiner Tochter nur hinterher, sie solle aufpassen wegen den bösen Randalierern, die sich unter die guten Demonstranten mischen, der „schwarze Block“ zum Beispiel. Aber halt: War dieser Begriff überhaupt sozialverträglich?
Das Rätsel blieb bestehen, warum nun gerade das BLM-Thema dermassen aktuell war. Weder gab es ein ausgeprägtes Rassismus-Problem in der Schweiz, noch systematische Übergriffe durch die Polizei. Könnte es vielleicht sein, dass es ganz einfach keine anderen Probleme gab? Oder war dieses ur-amerikanische Problem nur ein Ablenkungsmanöver von der in unserem Land tatsächlich existierenden Ausländerfeindlichkeit? Ein Rätsel.
„Du Sau, du!“
Zudem wollte Waldmeier eigentlich ganz andere edukative Herausforderungen stemmen, als ethnisch-soziale Themen mit seiner Tochter besprechen (zumal sich die ganze Erziehung seiner beiden Kinder als ziemlich nutzlos herausgestellt hatte). Es ging nämlich um seinen Grossneffen Tim, vierjährig. Waldmeyer hatte sich kürzlich mit ihm durch den Zoo gequält. „Hoi, du Sau, du!“, rief Tim vor dem Wildschweingehege. Waldmeyer war verunsichert. Sollte er seinen Grossneffen nun zurechtweisen? Als Sau bezeichnet zu werden, ist nicht sehr nobel. Tim könnte dies vielleicht auch bei Nichtsauen tun. „Tim, das ist eine korrekte Bezeichnung – weil es ein Schwein ist. Du darfst aber Nichtsauen auf keinen Fall mit Sau ansprechen.“ Erziehung und Sozialisierung sind gar nicht so schwierig, dachte sich Waldmeyer.
Der Mohr aus dem Morgenland
Am nächsten Morgen, bei seiner Meditation (es handelte sich de facto um sein normales singuläres Brainstorming), starrte Waldmeyer in die Tasse mit dem schwarzen Kaffee und fragte Charlotte, ob man einen „Affen“ noch einen „Affen“ nennen dürfe. Sie antwortete nicht. Es war Sonntag, weshalb auch Noa (21), noch etwas übernächtigt und vermutlich noch gar nicht nüchtern, am Tisch sass. Auch Lara, mit roten Augen, sie hatte am Vorabend an der Demo etwas Tränengas abbekommen. Aber Waldmeyer war in Gedanken ganz woanders: Er fragte sich, wer jetzt wohl die Weihnachtsgeschichte umschreiben müsse. Denn das mit dem Mohr aus dem Morgenland ging wohl nicht mehr durch. Als sein Sohn Noa noch zur Schule ging, gab es zu Weihnachten diese Krippenspiele, und einer der Jungs mimte jeweils den Mohren. Waldmeyer erinnerte sich genau: Es war 2008, nämlich kurz nach Lehman Brothers. Aber nicht Noa, sondern Skodran aus Pristina durfte den Mohren mimen. Skodran war etwas dunkelhäutig, also entfiel das Kopfschwärzen – soweit ein ganz praktischer Entscheid der serbischen Lehrerin, welche im Übrigen weitsichtig darüber hinwegsah, dass Skodran Moslem war. Skodran war damit jedoch eine mehrfach glückliche Wahl, denn der Typ aus dem Morgenland war sicher kein Christ. Es war auch Glück für die Lehrerin dabei, denn sie ahnte damals noch nicht, dass „blackening“, also das Kopfschwärzen, überhaupt nicht ging. (Premierminister Trudeau holten in dieser Causa kürzlich seine Jugendsünden ein.)
„Diese Person aus dem Morgenland, war das nun ein Mohr, ein Farbiger oder ein Schwarzer?“, rätselte Waldmeyer laut. „He, he, that’s the N-word“, warf Noa ein. „Bitte“, intervenierte Charlotte, „es war einfach ein Ausländer“.
Waldmeyer fühlte sich bestätigt, dass seine Erziehung vergeblich gewesen war und stellte gleichzeitig fest, dass seine Frage nicht beantwortet wurde. „Der Ausländer aus dem Morgenland“? Ein Pleonasmus fast. Die konnotativen Probleme häuften sich. Wenn es keine Mohren, Farbigen, keine „Coloreds“, keine Rothäute und keine Gelben, vielleicht auch keine Cafés au lait mehr geben darf: Wie dürfen wir sie denn nennen? Vielleicht bleiben wenigstens „Schwarz“ und „Weiss“ der Sprache erhalten? Und wen sollte das alles eigentlich noch interessieren in einem entwickelten 21. Jahrhundert…?
„So, der Whiteman geht jetzt in den Newsroom!“, verabschiedete sich Waldmeyer vom Frühstückstisch. In seinem Büro reflektierte er, ob es ihn stören würde, „Gringo“ genannt zu werden. Mehr noch beschäftigte ihn der schwierige Vorfall mit seinem Grossneffen Tim kürzlich im Zoo. War das auch ein BLM-Fall? Aber so dunkel waren die armen, eingesperrten Wildschweine gar nicht. Eher „farbig“ eben. Aber das war wohl auch wieder falsch.
________
12.7.2020
Waldmeyers makroökonomischer Albtraum 2027
Immer diese Albträume
Es war wieder einer dieser Albträume, der Waldmeyer schweissgebadet aufwachen liess. Immerhin handelte es sich dieses Mal um einen sehr prospektiven, ja visionären Traum. Bisher dachte Waldmeyer immer, dass man sich einfach an Warren Buffet halten sollte. Der bekam in der Retrospektive nämlich meistens recht, was die künftige Entwicklung der Märkte betraf. Schon damals bei der Dotcom-Blase. Und heute, immer noch im Corona-Modus, hält Buffet ganz einfach cash – und macht vorab nichts. Waldmeyers Albtraum ging nun aber über diese clevere Strategie hinaus, es war ein kristallklarer Blick in die Zukunft – und deshalb umso wertvoller.
2027
Das Jahr 2027, so Waldmeyers fürchterlicher Traum, war nämlich plötzlich von einer geld- und währungsmässigen Zeitenwende gezeichnet. Doch zurück auf der Zeitschiene. Es kam so: Die EZB hatte in den Jahren ab 2020 unablässig gigantische Summen an Geld und Schulden „produziert“. Und Italien lag bereits 2023 einmal mehr auf dem Operationstisch, im Koma quasi, mit einer letzten Operation am offenen Herzen. Waldmeyer machte sich – im Traum, wohl verstanden – sofort betreffend dem Nachschub von seinem Lieblingswein (Terre Brune, Sardinien) Sorgen.
Italien bankrott, auch Spanien und Griechenland
Der Bankrott Italiens auf jeden Fall war nicht mehr aufzuhalten: keinerlei Reformen in Sicht, Investoren zogen sich alle zurück, das Bankensystem kollabierte, der Schuldenstand lag bei 255% des BIP, Geld war nur noch via die unzähligen Eurorettungsschirme zu erhalten. Die EZB warf nicht Milliarden, sondern Billionen auf. Somit war Waldmeyers Albtraum nur eine natürliche Rückkoppelung von all den geld- und finanzpolitischen Übeltaten der Vorjahre. 2024 kam der Kollaps von Spanien hinzu, 2025 meldete Griechenland die Zahlungsunfähigkeit an. Schon wieder.
Hyperinflation
Noch im gleichen Jahr, 2025, setzte die Inflation ein – und zwar massiv. Die post-Corona-Deflation war Geschichte, nun kam, und zwar mit Wucht, die Retourkutsche für die irre Vermehrung der europäischen Geldmenge. Die Inflation war deutlich zweistellig. Immerhin, die Immobilien hielten sich gut. Aber die Bankguthaben sublimierten sich quasi, auch die Pensionen der europäischen Bürger. Geld war nichts mehr wert. Alle Euro-Länder waren davon betroffen. Bruno Spirig, Waldmeyers Cousin, triumphierte: Seine kleine Villa auf El Huerro gewann täglich an Wert, in Euro gemessen zumindest (pro memoria: Spirig hatte sich im Frühjahr 2020 mit vier erschlichenen Schweizer Corona-Krediten auf die Kanaren abgesetzt).

1 Euro = 0.62 CHF
Im Verhältnis zu anderen Währungen verlor nun der Euro noch massiver an Wert. Obschon tief im Rem-Schlaf, spürte Waldmeyer so etwas wie Schadenfreude. Albträume haben es an sich, dass man durchaus reflektieren kann. Deshalb lief es ihm, schlafenderweise, auch kalt den Rücken hinunter, als kurz ein Fetzen eines Charts aufflackerte, der den Eurokurs bei 62 Rappen zeigte. Waldmeyer versuchte sich krampfhaft an den Stand seines Eurokontos bei der UBS zu erinnern. Er schaffte es nicht.
Börsencrash – global
Die Börse crashte bereits Monate zuvor: Die gehandelten Werte hatten sich inzwischen weit von der Realität entfernt. Die Notenbanken kauften zwar noch lange und ungehemmt Papiere an der Börse auf – zumindest bis zum Regierungswechsel in den USA und zur Abwahl an der EZB-Spitze. Aber irgendwann war Schluss, das Fuder war überladen. Der Crash kam rasch und heftig, die Indizes fielen um 70% und rissen global alle Börsen in den Strudel. Das Konterfei von Waldmeyers Banker schwebte kurz vorbei, dieser riet ihm dringend zum Nachkaufen. Er könne doch seinen Goldbestand – inzwischen verdreifacht im Wert – investieren. Der Banker verschwand jedoch vor dem geistigen Albtraum-Auge so rasch, wie er gekommen war. Denn die Ereignisse draussen in der Wirtschaft überstürzten sich:
23. November 2026: Der Allamann wird eingeführt
Es geschah über Nacht, am 23. November 2026. Der Euro wurde de facto abgeschafft. Nein, die Länder kehrten nicht zu ihren ursprünglichen Währungen zurück, es gab nicht wieder Peseten, Kronen oder Francs. Es gab auch keinen Eurosplit, nämlich einen potenten „Nordeuro“ und einen lendenlahmen „Südeuro“, wie noch kurz zuvor prophezeit wurde. Es kam ganz anders: Die nördlichen Eurostaaten „schenkten“ den faulen Euro einfach den Südstaaten, schafften aber gleichzeitig eine eigene neue Währung, nämlich den Allamann. Ein Allamann entsprach 100 Merkel. Nebst Deutschland und allen nördlichen Euroländern machten auch die Nicht-Euromitglieder Dänemark, Island und alle östlichen Staaten sofort mit. Norwegen führte – als Nicht-EU-Land – den Allamann geschickt zum fixen Wechselkurs als Zweitwährung ein. Belgien entschied sich, nach kurzem Ringen, für den Allamann und nicht für den Alteuro, die tüchtigen Flamen setzten sich erwartungsgemäss gegen den inzwischen moslemisch dominierten frankofonen Teil des Landes durch. Alles geschah über Nacht.
Negative Preise für Griechenland-Ferien…?
Die Südstaaten wurden mit ihrer kaputten Währung nun spottbillig, konnten sich vor der fortschreitenden Hyperinflation aber nicht wehren. Der taumelnde Euro setzte seinen Weg Richtung Süden fort. Charlotte erschien kurz im Traum, mit roten Augen und ziemlich verstört. Sie wedelte mit ihrer I-Pad-Folie (die gab es ab 2026 aus Taiwan), darauf ein Urlaubsangebot für Griechenland. Es wurde ein negativer Preis angeboten (ohne Flug allerdings), aber man erhielt ein Kilo Euronoten pro Übernachtung. Ein negativer Preis in Euro – nicht unbedingt schockierend, Waldmeyer hatte ja schon 2020 erwogen, zu einem negativen Preis seinen Öltank zu füllen.
Die Aufgabe des Schweizer Frankens
Aber zurück zum Albtraum: Schon vorher war der Schweizer Franken explodiert. Der Auftrieb liess sich leider auch durch die Allamann-Einführung nicht stoppen, und am 1. Januar 2027, um 00:00 wurde der Schweizer Franken aufgegeben. Die Eidgenossen führten den US-Dollar ein. Sie hatten keine Wahl mehr. Den Allamann wollte man nicht, dass wäre für die Bürger psychologisch nicht zumutbar gewesen. So wurde ein Franken zu 1.50 US$ konvertiert. Ein Drama für die Exportnation, aber zumindest hatte man nun Ruhe.
Und dann am Frühstückstisch
Am nächsten Morgen am Frühstückstisch war Max noch etwas angeschlagen. Er war gerade mit der online Weinbestellung für den dringenden Nachschub an Terre Brune beschäftigt, als Charlotte ihn fragte, warum er sie – mitten in der Nacht – nach dem Stand des Eurokontos fragen wollte.
„Stimmt. Wir sollten die Euros schnellstmöglich einfach ausgeben. Der Wechsel in Allamann ist zu kompliziert.“
Charlotte schaute entgeistert und entschied, nicht weiter nachzufragen. Sie blätterte weiter in den Ferienprospekten. Als Waldmeyer zu seiner Frau hinüberschaute, erschrak er und verschüttete seinen Kaffee: Es waren Unterlagen für Griechenland.
_________________
5.7.2020
Max Waldmeyer und die Dunkelflaute
Waldmeyer faszinierte der Begriff. Die „Dunkelflaute“ ist eine deutsche Wortschöpfung, die sich aus der Kombination von „dunkel“ und „Flaute“ ergeben hat. Soweit nachvollziehbar. Gemeint ist der energiemässig unangenehme Vorgang, dass zu gewissen Zeiten weder die Sonne scheint, noch ein Windchen weht. Die Solarpanels kriegen also zum Beispiel in der Nacht keine Arbeit, und die Windräder drehen sich nicht bei Windstille. Das Zusammentreffen beider Ereignisse, die Dunkelflaute eben, führt logischerweise zu einem Produktionsstopp von Strom.

Das wäre indessen nicht so tragisch, falls es auch künftig noch andere Quellen von Strompoduktionen gäbe. Aber Deutschland hat, wie wir wissen, die „Energiewende“ beschlossen. Also künftig keine Atomkraftwerke mehr, keine Kohlekraftwerke. Nada Tschernobyl-Risiko, nada CO2. Ein hehrer Anspruch. Wenn da nur die blöde Dunkelflaute nicht wäre, und wenn da nur der Umstand nicht wäre, dass wir Energie bis heute kaum nachhaltig speichern können. Das konnte auch der clevere Elon Musk mit seinen Grossbatterien bis heute nur unbefriedigend lösen.
Sollte Waldmeyer nun seinen Porsche Cayenne (schwarz, innen auch), gelegentlich einmal, wenn auch schweren Herzens, durch ein hybrides oder vollelektrisches Fahrzeug ersetzen, so würde er es in der Schweiz natürlich nur mit sauberem Strom aufladen. Der kommt bekanntlich von unseren sauberen Wasserkraftwerken. Eigentlich von den sauberen Stauseen, bzw. den sauberen Speicherkraftwerken. Zu gewissen Zeiten wird für diese mit dem überflüssigen Dreckstrom aus Deutschland oder Frankreich das Wasser wieder rauf in diese schönen künstlichen Bergseen gepumpt. Den Strom für diesen Pumpvorgang beziehen die Schweizer erst noch zu Negativpreisen (sie erhalten als noch Geld für den Stromkauf), die Dreckschleudern im Ausland können ja nicht abgestellt werden und müssen ihre Elektroenergie auf Teufel komm raus loswerden. Zum richtigen Bedarfszeitpunkt kann dann bei uns mit den Wasserkraftwerken wieder sauberer Strom produziert werden. Diese geniale Umwandlung, so dachte sich Waldmeyer, ist eigentlich wie eine von Mensch geschaffene Photosynthese: CO2 wird quasi vernichtet.
Natürlich wusste Max Waldmeyer, dass mit diesem raffinierten Prozess nur ein Teil des Stroms „gesäubert“ wird. Immerhin haben wir in der Schweiz keine Dunkelflaute. Wasser können wir immer runterfliessen lassen und so Strom produzieren, den Alpen sei Dank. Nur reicht es nicht für alle. Man müsste also mehr Wasserkraftwerke bauen, ganze Talschaften sperren und riesige Stauseen anlegen. Man könnte z.B. das ganze Wallis stauen – vom Aletschgletscher bis kurz vor Monthey. Die Bewohner des eh dünn besiedelten und nicht sehr wirtschaftskräftigen Kantons könnten an die schönen Hanglagen umgesiedelt werden (mit Blick auf den neuen See), der Tourismus so auch im Tal unten angekurbelt werden. Alles könnte spielend mit dem zeitoptimierten Stromverkauf an Deutschland finanziert werden. Während den Perioden der teutonischen Dunkelflauten eben. Unser Strom wäre dann sau-teuer, die Deutschen hätten aber keine Wahl.
„Charlotte, wir sollten wieder einmal ins Wallis“, meinte Max. Charlotte ahnte bereits, dass etwas faul war bei diesem Vorschlag. Max murmelte noch etwas von einer „demnächst grossen Baustelle im Wallis“ und blätterte weiter in den Autoprospekten.
______________
28.6.2020
Max Waldmeyer und diese Luftbuchungen
„Charlotte, diese Luftbuchungen nehmen stark zu“, meinte Max, vor seinem PC sitzend.
„Aber es wird doch viel weniger geflogen?“, antwortete seine Frau.

Waldmeyer fühlte sich wieder einmal missverstanden. Es ging nämlich gar nicht um Buchungen von Flugtickets, überhaupt nicht um die Airlines.
Sondern um Buchungen bei Wirecard. Um diese kunstvollen Kunstbuchungen, welche zu einem plötzlichen Loch in den Büchern der Firma von eben künstlichen 1.9 Mia Euro geführt hatten. Die verbuchten Summen hatten leider wohl gar nie bestanden, immerhin aber zu einer schönen Entwicklung des Aktienkurses beigetragen. Dennoch galt es, den Finanzchefs der Firma Wirecard einen gewissen Respekt zu zollen: Die virtuellen Buchungen waren nämlich sehr raffiniert. „Luftbuchungen“, wie die einschlägigen Zeitungen nun vermerken. Abgesehen von der kriminellen Energie, die hinter den schlauen und bilanzfälschenden Konstruktionen steckte, zeugten diese nämlich von grosser Kreativität. Wie ist es möglich, über einen längeren Zeitraum alle Revisoren, Behörden und Anleger mit solchen Riesensummen hinters Licht zu führen? Eine virtuelle Geldschöpfung ungeahnten Ausmasses. Alle Achtung.
Aber eigentlich machen auch Staaten vermehrt Luftbuchungen. Sie schöpfen Geld, sie lassen die Notenpresse in Rekordgeschwindigkeit drucken, halten die Zinsen tief, kaufen Anleihen auf. Sie lassen die Schulden explodieren und unterstützen – so in der EU – Staaten, die eigentlich bankrott sind und vor allem alles andere als reformwillig. Gigantische Schuldenberge türmen sich auf, und nur Nullzinsen für lange, lange Zeit bewahren diese Länder vor dem Kollaps. Die nächste Generation wird nie mehr richtig sparen können, da es keinen Zins mehr geben wird. Auch die psychologische Lust am Sparen wird so im Keime erstickt. Die Zinseszinsrechnung in den Schulen wird wohl demnächst abgeschafft – weil sie einfach obsolet geworden ist. Vielleicht werden auch die Rentenberechnungen verboten, weil sie leider nur noch auf der Addition von Summen basieren, nicht aber auf einer natürlichen Vermehrung via einer Verzinsung.
Der Italiener Draghi hatte bei der EZB vor gut zehn Jahren mit diesen Untaten begonnen. Mit allerlei semi-ökonomischen Begründungen führte er das „Quantitative Easing“ ein. Geldschöpfung einfach. Basierend nicht auf Wertschöpfung, sondern – und jetzt schliesst sich der Kreis zu Wirecard – letztlich auf „Luftbuchungen“. Hintergründig wollte Draghi, ein an sich gewiefter ex Goldman Sachs Banker, natürlich Inflation provozieren („zwei Prozent sind ideal“). Mit einer schönen kleinen Inflation, die nicht so störend wirkt, vernichten sich über die Jahre dann die Schulden der Staaten, schleichend quasi. Soweit der Plan.
Notenbanker haben, zusammen mit den Finanzpolitikern, erkannt, dass man einfach Anleihen auf den Markt werfen kann – möglichst zu Nullzinsen. Werden sie durch Institutionelle und Private nicht voll gezeichnet, werden sie kurzerhand durch die Staaten selber aufgekauft. Man schöpft also Geld mit Werten, die man gar nicht hat. Waldmeyer stellte sich vor, dass der Vorgang etwa so ist, wie wenn man den Ast absägt, auf dem man sitzt – einfach umgekehrt. Die Bilanzen der Notenbanken werden künstlich aufgebläht, parallel dazu die Bilanzen der Staaten – mit explodierenden Schulden.
Draghi war sozusagen der Erfinder dieser finanzpolitischen Misere. Nachzusehen ist ihm, dass er als Italiener auch keine andere Lösung sah, als die Märkte mit Nullzinsgeld zu schwemmen, damit die Schulden im Belpaese und den anderen Südstaaten bezahlbar bleiben.
Auch Negativzinsen sind staatliche Geldschöpfungen. Der Staat konfisziert. Dazu kommt nun noch das Helikoptergeld: Es wird an alle – unbesehen des Bedarfs – verteilt. Allerdings Geld, das man noch gar nicht hat. Das ist Diebstahl an der ökonomischen Zukunft der nächsten Generation.
Waldmeyer kokettierte mit dem Gedanken, den noch jüngst gefeierten und nun tief gefallenen Markus Braun (der Kopf bei Wirecard) zu rehabilitieren. Eigentlich waren seine Verfehlungen gar nicht so schlimm, verglichen mit denen der staatlichen Buchhalter. Wer nun wirklich zu Schaden gekommen ist bei Wirecard? Ein paar der Spekulation anheimgefallene Aktionäre?
Die Verfehlungen der Staaten (in Billionenhöhe) relativieren also die Verfehlungen bei Wirecard. Draghi muss wohl nie ins Gefängnis, vielleicht jedoch Braun.
„Charlotte, dieser Draghi gehört eingesperrt, nicht der arme Braun von Wirecard – der ist nur ein Nachahmungstäter!“
„Max, wolltest du nicht endlich deine Kreditkartenrechnungen bezahlen?“
_______________
20.6.2020
Waldmeyer und die Sharing Economy
Für Waldmeyer war die Sharing Economy eigentlich ein alter Hut. Er erinnerte sich daran, dass Claudia, seine ältere Schwester, einmal einen Sommer in einem Kibbuz verbracht hatte. Das war wohl ein Vorläufer der Sharing Economy, denn er beruhte ebenso auf Freiwilligkeit. Dieses Modell damals war vor allem nicht zu verwechseln mit den sozialistischen Feldversuchen vieler Staaten – gerade zu jener Zeit. Kibbuz auf jeden Fall war damals der Renner; jeder, der in Israel in einem solchen freien Arbeitslager (oft mit ebenso freier Liebe verbunden) einen Sommer verbrachte, stieg in der sozialen Leiter seiner Bezugsgruppe mehrere Stufen nach oben. Natürlich wusste man damals nicht, dass man zu einer Sharing Economy gehörte.
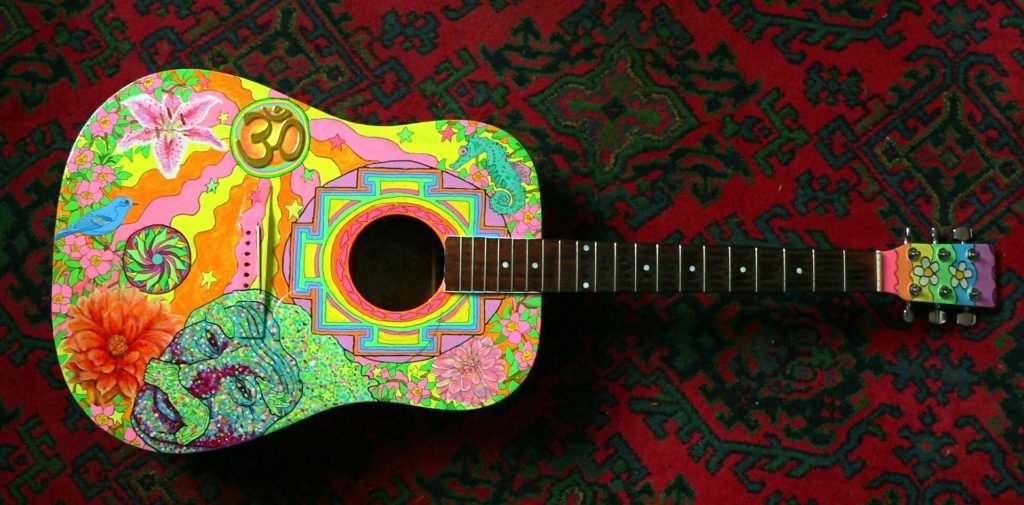
Waldmeyer selber ist nicht vollkommen abgeneigt – zumindest partiell – bei der Sharing Economy mitzumachen. Nur ein Beispiel: Kürzlich mietete er im Baumarkt eine dieser Vertikutiermaschinen für seinen Rasen. Ein klassisches Sharing. Früher benutzte er auch ab und zu ein Tram, noch früher ging er ins Schwimmbad. Auch hier teilte man etwas, man war sich dessen einfach nicht so bewusst. Und es hiess schon gar nicht „Sharing“. 2019 auf Ibiza hatte Waldmeyer diesen Elektro Scooter gemietet, hatte sich dann allerdings den Knöchel verstaucht. Und Wikipedia gehört zu seinen Lieblings-Homepages. Auch das ist Sharing Economy. Solche Sachen teilt man ja ganz gerne – zumal (im letzteren Fall) das Teilen dann, im ursächlichen Sinne, gratis ist.
Aber eigentlich möchte Waldmeyer gar nicht teilen. Seinen Porsche Cayenne z.B. (schwarz, innen auch) würde er nur ungern ausleihen, geschweige denn teilen. Vermutlich war das echte Teilen jedoch gar nicht die Idee der neuen Sharing Economy, denn diese verfolgt eine klare Wertschöpfungs-Strategie, ist bestenfalls sogar an der Börse kotiert. Da gibt es exakte Eigentumsverhältnisse. So auch bei Airbnb oder Ebay. Das hat in der Tat gar nichts mit selbstlosem „Teilen“ zu tun; der bisher positiv besetzte Begriff des „Sharing“ wird sozusagen persifliert.
Auch die Hunde, die sich die Spanier kürzlich ausliehen, um während dem Lockdown die Ausgangssperren mit Gassigehen zu umgehen, sind nur eine moderne Ausprägung der geldschöpfenden Sharing Economy. Die Tiere wurden nämlich vermietet, für bis zu 16 Euro pro Stunde. Die Sharing Economy ist also vor allem ein Geschäftsmodell, welches nichts mit altruistischem „Teilen“ zu tun hat.
Waldmeyers jüngere Schwester Gabi zum Beispiel liebt Sharing Economy. Sie lebt in Zürich, im Seefeld, ist Ende 40, ledig, trägt weisse Nike-Sneakers. Waldmeyer fand nie genau heraus, was sie wirklich arbeitet, aber sie tat es in einem chicen Co-Working-Space. Sie liebt Uber, auch Airbnb – und alle Apps. Sie hat kein eigenes Auto, besitzt aber ein ziemlich cooles Elektrobike (welches sie allerdings auf keinen Fall teilen würde) sowie einen Fahrausweis (Prüfung für Automaten). Wenn sie zu Ikea fährt, chartert sie ab und zu ein Fahrzeug von Mobilitiy (man erkennt diese an der roten Farbe und der unsicheren Fahrweise). Bei Ikea fühlt sie sich dann mitten in einer Sharing Economy, in einer Ersatzfamilie quasi. In einer allerdings, welche ganz normal Geld nimmt. Gabi geht übrigens auch gerne aus – da ledig. Während der Corona-Krise brach ihr Lebensentwurf allerdings in sich zusammen. Der Co-Working-Space wurde geschlossen, Mobility stellte den Betrieb vorübergehend ein, Uber hatte Desinfektionsprobleme, Airbnb war eh nicht gefragt und die coolen Locations am Abend waren geschlossen. Es blieben nur die Apps. Gabi war nahe einer Depression, sie taxierte es allerdings als „Burnout“. Waldmeyer fragte sich, ob die Sharing Economy gar nicht krisentauglich ist – zumindest nicht Pandemie-tauglich.
Philipp Kohler, Waldmeyers Neffe, machte Waldmeyer auf zwei interessante Sachverhalte aufmerksam. Einerseits erklärte er ihm das Fractional Share Trading: da er sich mit seinem Studentenbudget kein sinnvolles Portfolio an der Börse aufbauen könne, beschränke er sich bei seinen Tradings eben auf den Kauf einer Fraktion einer Aktie – dann aber von ganz vielen verschiedenen Aktien. Und mit den Gratis-Daytrading-Konten könne er nun nicht nur an der Sharing Economy teilhaben, sondern auch ein Vermögen verdienen. Waldmeyer war nun auch klar, warum sich mit solchen Tendenzen der von ihm seit drei Monaten prognostizierte Börsencrash noch etwas verzögern wird, jedoch mit Bestimmtheit näher rückt.
Aber Philipp Kohler gab ihm noch einen anderen nützlichen Hinweis: Er meinte nämlich, dass die Leute aus dem Balkan die Sharing Economy schon seit langem kennen. Diese investieren oft zusammen in ein Fahrzeug, oft einen 5-er BMW (nur Limousine, nicht Kombi, entweder schwarz oder dunkelblau). Man erkennt diese Fahrzeuge mit den verdunkelten Scheiben am durchhängenden Fahrwerk, da die vier stolzen Besitzer, oft etwas korpulent, gemeinsam ausfahren. Die Sharing Economy wird so immerhin überleben, dachte sich Waldmeyer. Auch in der digitalen Form: Die jüngere Generation teilt zumindest gerne ihre persönlichen Daten. Aber eigentlich geht es ja um Economy – und nicht um Sharing.
_________________
14.6.2020
Waldmeyer und die Ökobilanz
Waldmeyer rieb sich die Augen ob der deutschen Corona-Hilfe: Bis zu 9‘000 Euro Fördergeld erhält man bei einem Kauf eines Elektrofahrzeugs! Corona hatte also durchaus auch seine Vorteile. Ob wohl Frau Merkel ein Teil der Swiss-Milliarde, die wir de facto nach Berlin geschickt hatten, nun für die Fahrzeug-Prämien verwendet? Waldmeyer überlegte auch, ob man nun diesen Tesla – das SUV-Modell – in Deutschland bestellen sollte. Das Fördergeld könnte einkassiert und der Sauberschlitten anschliessend in die Schweiz importieren werden. Er verwarf den Gedanken jedoch wieder und hoffte, dass sein Cousin Bruno Spirig nicht auf eine solche Idee kommen würde (pro memoria: Bruno Spirig hatte bei vier Banken überlappende Corona-Kredite bezogen und sich dann auf die Kanaren abgesetzt).

Der C02-Verbrauch ist natürlich ein Ärgernis. Waldmeyer plagte ab und zu tatsächlich ein schlechtes Gewissen. Auch wenn er diesen „Ökostrom“ für seine Villa im Einzugsgebiet von Zürich abonniert hatte – es war ihm immer noch nicht klar, wie gerade er diesen sauberen Strom aus der Steckdose extrahieren sollte.
Aber eigentlich plagten Waldmeyer ganz andere Sorgen: Er machte sich seit längerem Gedanken betreffend einem „Second Home“, einem zweiten Lebensmittelpunkt quasi (2.LMP). Und nun sein ökologisches Dilemma in diesem Zusammenhang: Wenn dieser 2.LMP beispielsweise in der schönen Toscana zu liegen käme, liesse sich die zusätzlich erforderliche Mobilität, mit welchem Verkehrsmittel auch immer, nicht wegdenken. Auch die zusätzliche Umweltbelastung nicht.
Und je weiter weg ein Second Home läge, desto grösser wäre die zusätzliche Umweltbelastung. Das mit dem Fliegen wäre dann ganz klar suboptimal. Konsequenterweise könnte er, so das Ergebnis seines singulären Brainstormings, einen 2.LMP in relativer Nähe wählen. Also beispielsweise eben doch in der Toscana. Und dann jeweils mit einem elektro-gespeisten Tesla runtergleiten.
Allerdings hatte er nun bei seinen weiteren Recherchen etwas sehr Unappetitliches entdeckt: Alleine das grösste deutsche Kohlekraftwerk Neurath stösst genau zehnmal mehr CO2 aus als der gesamte Schweizer Luftverkehr – nämlich über 50 Millionen Tonnen pro Jahr! Er verifizierte die Zahlen nochmals, und das Desaster bestätigte sich. Das waren die offiziellen Berechnungen der zuständigen Bundesämter in Deutschland und der Schweiz, Basis 2018. Zusätzlich war klar, dass die Schweiz in ganz erheblichem Umfang Strom aus Deutschland bezog.
Zum Glück hatte er also diesen zu 100% elektrobetriebenen Tesla doch nicht bestellt, schoss es Waldmeyer durch den Kopf. Dieser fährt nämlich de facto mit Braunkohle, via den dreckigen Strombezug, vermutlich gerade aus Neurath! Also doch besser fliegen?
Am Sonntagmorgen beim Brotholen (mit dem Elektrobike) fühlte sich Waldmeyer plötzlich leichtherzig und rehabilitiert: Seine persönliche Verkehrsbilanz, selbst unter Einbezug seiner 2.LMP Pläne, war eigentlich gar nicht so schlecht!
Beim Frühstück versuchte er Charlotte seine klimapolitischen Schlüsse nochmals darzulegen. „Es wäre sinnvoll, wenn wir ein Second Home möglichst weit weg wählen würden, sodass wir dahin fliegen müssten. Und das Brot habe ich vorhin übrigens mit dem Elektrobike geholt“, schloss er triumphierend seine Ausführungen. „Mit dem Elektrobike? Also warst du sozusagen in Neurath, nicht?“, entgegnete Charlotte. Waldmeyer war perplex – und verunsichert.
________________
10.6.2020
Waldmeyer und seine ökonomische Erklärung in Sachen Toilettenpapier
Waldmeyer konnte die Geschichten über die Hamsterkäufe von Toilettenpapier während den ersten Tagen der Corona-Krise nicht mehr hören. Probleme diesbezüglich wurden sogar aus Australien rapportiert. Das Thema war nun einfach durch.
Interessant schien ihm jedoch trotzdem die Geschichte von Reto Sonderegger, seinem Schwager. Aber dazu später.
Vorab versuchte Waldmeyer nochmals zu analysieren, wie es überhaupt zu diesen Lücken in den Verkaufsregalen kommen konnte. Es geht nämlich um eine sehr anspruchsvolle Variante der Spieltheorie aus den Wirtschaftswissenschaften. Für diese Theorien wurden schon verschiedene Nobelpreise verliehen. Die Analyse von komplexen Entscheidungssituationen eignet sich nämlich auch für diese Miseren mit dem fehlenden WC-Papier. Es geht um die eigenen und die fremden Entschlussfassungen, welche sich gegenseitig in Abhängigkeit bringen. Wie beim Schach eigentlich. Menschen sind nämlich egoistisch. Falls ihr Rollenverhalten nicht so wäre, gäbe es immer gleich viele Rollen im Gestell.
Natürlich hatte sich auch Reto Sonderegger im März 2020 nur als homo oeconomicus verhalten wollen. Oder einfach von Darwin inspiriert: survival of the fittest. Aber dazu eben später.
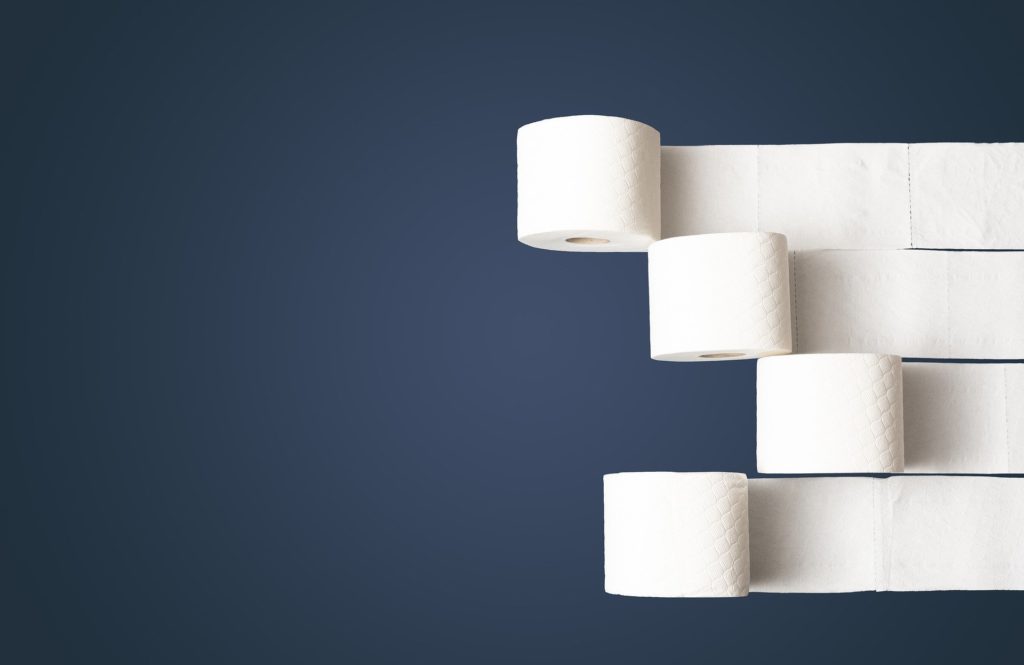
Waldmeyer begriff nun anhand dieser plötzlichen und erratischen Einkäufe von Toilettenpapier, was mit dieser Spieltheorie gemeint war. Die Entscheidungssituation für den Kauf, den Nichtkauf und das Volumen des Kaufes hingen also vom Wissen oder Unwissen über das Verhalten der andern Käufer ab. Zum Beispiel von seinem Nachbarn Freddy Honegger, dessen Verhalten Waldmeyer schon immer suspekt erschien. Ein nicht antizipierbares Verhalten eben, das plötzlich zu solchen überraschenden Hamsterkäufen führen kann. Die Auswirkung dieser erratischen Käufe in Sachen Toilettenpapier war indessen ein logistisches Phänomen – es ging um ein just-in-time Problem. Und an diesem Thema war Waldmeyer mental, da makroökonomisch gestählt, schon wieder näher dran: Niemand verkauft nämlich gerne Toilettenpapier, kein einziges Geschäft. Mühsam im Handling, hohe Transportkosten, hohe Lagerkosten, zu viel Platz im Gestell, tiefe Marge. Der Nettogewinn pro Rolle wäre eine eigene Glosse wert. Konsequenterweise halten alle Verkaufsgeschäfte nur so viel Ware feil, dass es gerade reicht – und der Nachschub erfolgt möglichst knapp und just-in-time eben.
Glücklicherweise wird in der Regel immer gleich viel von diesem Produkt verbraucht. Stuhlgänge sind einzelne Imponderabilien, wir können deren Anzahl, sagen wir über eine Woche, kaum beeinflussen. In deren Summe – und über das ganze Einzugsgebiet eines Ladens hinweg – ergibt sich deshalb ein ziemlich konstanter und gut planbarer Papierverbrauch. Aber nur, sofern die Logistikkette vom Laden bis zum Individuum nicht gestört wird. Wird plötzlich mehr gekauft (nicht verbraucht, wohl verstanden, denn dazu müsste es zu einem medizinischen Sonderfall in der Region kommen), so entsteht ein Manko in der Versorgung. Der Mehrverkauf ergibt sich also nur aus einem komischen Herdentrieb, welcher auf dieser Spieltheorie gründet. Damit schliesst sich der Kreis für dieses Rätsel: Die Geschäfte und die vorgelagerten Lieferketten sind schlichtweg nicht vorbereitet auf eine plötzliche und sinnlose Erhöhung der Nachfrage, weil diese Vorbereitung ökonomisch ebenso sinnlos wäre.
Nun zu Reto Sonderegger: Reto spürte die Verknappung einfach kommen. Also handelte er sofort und lud seinen Mercedes Kombi bis unters Dach mit den kostbaren Rollen. Autarkie war gefragt. Oder er könnte allenfalls ein Geschäft daraus machen, vielleicht dachte er sogar an einen Verkauf (mit Agio) an seinen Schwager, also an Waldmeyer. Und im Notfall könnte es auch für Covid-25 reichen. Zuhause beim Einräumen der Beute im Luftschutzkeller fragte ihn sein Frau Ursula, was er denn wolle mit diesen Rollen. Reto war nicht verlegen und erklärte sich souverän. Ursula brach jedoch in Tränen aus: „Reto, dieses WC-Papier ist nur 2-lagig! Das will ich gar nicht!“ Nun war Reto in der Tat in deep shit. Im wahren Sinne des Wortes eigentlich.
Waldmeyer schloss seinen Gedankenreigen ab und erhob sich von seinem schon im Jahr 2009 installierten Closomaten. Ein Hauch von Schadenfreude huschte über sein Antlitz. Und mit einem Kopfschütteln malte er sich aus, wie Sondereggers im August 2026 die letzte 2-lagige Rolle verbrauchten.
____________
3.6.2020
Waldmeyer reflektiert: Ist Corona eine Mentalitätsfrage?
Jetzt lichtet sich der Nebel: Neue wissenschaftliche Untersuchungen haben nachgewiesen, dass Covid-19 vor allem beim lauten Sprechen übertragen wird.

Waldmeyer hatte das mit dem laut Sprechen schon früher irritiert. Aufgrund seiner vielen Reisen hatte er auch schon mal die Theorie entwickelt, dass sich aus den Lautsprecherdurchsagen in den Airports der Zivilisationstand eines Volkes ableiten lässt. Das Phänomen verhält sich invers, also je lauter, desto tiefer der Entwicklungsstand. Plärrende, laute Lautsprecher mit unverständlichen Durchsagen weisen auf einen entwicklungsmässigen Nachholbedarf hin. Klar verständliche Mitteilungen (sowohl akustisch als auch inhaltlich), welche zusätzlich auch auf Englisch erfolgen, lassen auf eine höhere Platzierung im Zivilisationsranking schliessen. Die feinen Varianten dazwischen könnten uns eine recht präzise Einordnung erlauben – woraus sich eine Korrelation mit der Virusverbreitung ergeben könnte.
Diese wissenschaftliche Studie betreffend dem epidemisch gefährlichen lauten Sprechen bestätigte nun seine Vermutung. Die Lautstärke der normalen Kommunikation unter den Bürgern eines Landes bestimmt die Wahrscheinlichkeit der Tröpfchen-Übertragung. Gewisse Völker schätzen einfach Social Non-Distancing und lautes Artikulieren, sind deshalb virenmässig mehr gefährdet.
Die Schweden zum Beispiel, so die weitere Beobachtung von Waldmeyer, sitzen vorab in den Wäldern und beobachten Elche. Sie sprechen wenig. Deshalb hält sich auch die Virenübertragung in Grenzen. Ausnahme: Stockholm, denn dort wird viel und laut gefeiert. Kein Wunder, konzentrieren sich die Viren auf das damit vulnerable Stadtgebiet.
Die Italiener dagegen referieren gerne. Zusätzlich wird viel gestikuliert. Beides hatten wohl schon die Römer eingeführt. Seither liegt das laute und ausholende Artikulieren in der DNA des Bel Paese, und die Tröpfchen und Aerosole übertragen sich dergestalt nun mal besser.
Die Briten sind zwar nicht immun gegen Viren, aber immun gegen Vorschriften. Auch nach den Lockdowns herrschte im Hyde Park Partystimmung, Untergrund-Coiffeure boten in London nach wie vor akkurate Haarschnitte oder Dreadlocks an. Das Problem der Briten liegt jedoch in der körperlichen Nähe, welche sie, im Vergleich zu den Südländern allerdings unfreiwillig, praktizieren: beispielsweise dichtes Queuing-up oder engste Tuchfühlung im Parlament (wo regelmässig „order…!“ gebrüllt wird). Aufgrund der Nähe zueinander wäre an allen diesen Orten ein Flüstern geboten, was indessen nicht sehr praktikabel wäre – so im Pub zum Beispiel. Kein Wunder also, erreichte Corona auf der Insel eine Spitzenverbreitung.
Bei den Franzosen, so analysierte Waldmeyer weiter, ist es anders: Im Lande Molières wird einfach gerne doziert. Und die hohe Wichtigkeit jedes persönlichen Statements wird oft lautstark unterstrichen. Waldmeyer erinnert sich an die gehobenen französischen Restaurants, wo ihm die Kellner schon öfter in theatraler Weise verschiedene gastronomische Zurechtweisungen erteilten. Aber vielleicht lag das Problem der hohen Infektionszahlen doch eher in den Banlieus? Dort wird nicht nur laut gesprochen, sondern die Anweisungen Macrons sind vielleicht gar nicht angekommen. Er spricht ja kein Arabisch. Waldmeyer überlegte noch kurz, ob es in Frankreich wohl Hygienegründe seien, welche die Verbreitung des Virus beschleunigt hatten. Die Bilder von Louis XIV, Versailles, die Perücken, Parfüms – es schoss ihm alles durch den Kopf. Er liess jedoch von dem Gedanken wieder ab und konzentrierte sich auf die Analyse des ethnischen Sprech- und Distanzverhaltens.
Ein echtes Problem scheinen die Spanier zu haben: Sie sind es gewohnt, dicht voreinander zu stehen und trotzdem ihr Sprechvolumen so hoch zu halten, als ob sie sich in einem Olivenhain beim Pflücken befänden. Eine Mentalitätsfrage, klar. Sie tun das konstant und überall, was wohl allenthalben einer Covid-19-Dusche gleichkommt.
„Charlotte, warum gibt es nicht einen Sprech-Lockdown in gewissen Ländern?“
„Du sprichst doch auch viel, Max. Und seit zehn Minuten murmelst du vor dich hin.“
Waldmeier dachte für sich, dass er nicht murmelt, sondern denkt. Und so zumindest nicht kontaminiert. Er beendete sein singuläres Brainstorming mit der Synthese: Insbesondere südliche Länder erreichen schneller eine höhere Infektionsrate, weil deren Population lauter spricht und ein prägnantes taktiles Verhalten zeigt.
_______________
29.5.2020
Waldmeyer und die klammen Bundesfinanzen
Waldmeyer hatte sich noch nie Sorgen um die Bundesfinanzen gemacht. Solange es keine Steuererhöhungen und andere neue fiskalische Plagen gab, kümmerte er sich nicht allzu sehr um die Buchhaltung des Finanzministers. Aber jetzt war plötzlich alles anders: Die Corona-bedingten Lockdowns rissen ein alarmierendes Loch in die Bundeskasse.

Waldmeyer war sich sicher, dass er selber im Jahre 2020, wohl auch 2021, aufgrund der wirtschaftlich herbeigezauberten Misere weniger Steuern abliefern würde. Er persönlich, seine Firma (Digitalsteuerungen für HLK, also Heizung-Lüftung-Klima), auch Charlotte (Interior Design), welche nun ebenso deutlich weniger Aufträge erhält. Alle Waldmeyers, Charlottes und Firmen zusammen würden also mit Bestimmtheit aktuell weniger Steuern abliefern. Die Extrapolation auf ein nationales Niveau würde logischerweise zu happigen Mindereinnahmen beim Bund führen. Das hatte Ueli der Maurer vielleicht noch gar nicht einberechnet. Diese Mindereinnahmen galt es nun zu den Corona-Ausgaben zu addieren. Waldmeyer schätzte die krisenbedingten Budgetdefizite der Jahre 2020 und 2021 auf insgesamt mindestens 60 Milliarden CHF. Und nun möchte Ueli die angehäuften neuen Schulden nicht binnen 6 Jahren, sondern binnen 30 Jahren zurückbezahlt sehen. Damit dürfte auch Druck von seinen Schultern fallen, könnte so das Problem doch elegant quasi atomisiert werden – nämlich in jährliche Kleinsttranchen von 2 Milliarden. Ein Trinkgeld fast für jedes Fiskaljahr, angesichts der Überschüsse, die die Schweiz bisher erarbeitet hatte.
Waldmeyer war nicht entgangen, dass sich Ueli schon im April von dem hohen Delkredere-Risiko der Corona-Firmenkredite distanziert hatte. Verluste, welche unweigerlich haargenau nach 5 Jahren, nämlich im April 2025 eintreten werden, pünktlich zu den Rückzahlungsterminen – dann, wenn eben nicht zurückbezahlt wird. Zu jenem Zeitpunkt würde Ueli natürlich nicht mehr Finanzminister sein, und Waldmeyer fragte sich nochmals, welcher staatliche CFO sich denn für diesen Himmelfahrtsjob 2025 zur Verfügung stellen würde.
Die Eidgenossenschaft weiss an sich, wie man angehäufte Defizite abbaut: In den letzten 11 Jahren gelang es, die Schulden vom Peak mit rund 120 Milliarden auf 97 Milliarden per Ende 2019 runterzufahren. Also um rund 2 Milliarden pro Jahr. Die Zahl kennen wir also schon. Da sollte es doch möglich sein, dieses finanzpolitische Kunststück während den nächsten 30 Jahren zu wiederholen! (Nun, gut: allerdings ohne diese Milliarden aufgrund der voraussichtlichen Corona-Kreditausfälle im April 2025.) Und Zinskosten müssen eh nicht eingerechnet werden, die Zinsen sind im Moment ja bei null.
Dieser 30-Jahre-Plan des Bundes zeugt also von einer gewissen Weitsicht. Natürlich würden den grossen Teil der Rückzahlungen – unter anderem – Noa und Lara bezahlen, also Waldmeyers Kinder. Diese sind seit kurzem im Erwachsenenalter, also müssten sie diese Beträge eben zusätzlich erarbeiten. Die heutige Generation allerdings, welche die Schulden verursacht hatte, wäre damit mehr oder weniger aus dem Schneider. Auch der Ueli, denn der Spardruck sinkt damit beträchtlich.
Noa jedoch belästigte nun seinen Vater mit ärgerlichen Fragen: „Dad, was ist, wenn während den nächsten 30 Jahren eine zweite Pandemie kommt? Oder eine andere Krise, so eine gemeine Cyberattacke? Oder ein Tsunami? Könnten wir uns dann leisten, nochmals ähnliche Schulden aufzubauen?“Waldmeyer überlegte kurz. „Mach dir keine Sorgen, Noa. Wir können das. Die Italiener allerdings nicht. Ausserdem gibt es keine Tsunamis bei uns. Bei irgendeiner neuen Krise wäre es dann eben an euch, dieser einfallsreich zu begegnen. Ausserdem bleiben die Zinsen vielleicht während 30 Jahren bei null, die Kredite kosten also gar nichts!“ Natürlich war Waldmeyer, sowenig wie Noa, mit dieser Antwort zufrieden. Vor allem hatte er jetzt genug von diesen Lockdowns. Zum Glück war nun das Tre Fratelli wieder offen.
_____________
Waldmeyer und die Costa Corona
Waldmeyer hatte seinen Schwager Reto Sonderegger noch gewarnt: den Sommerurlaub nur nicht im Süden verbringen dieses Jahr! Reto und Ursula zeichneten sich jedoch schon immer durch eine hohe Beratungsresistenz aus. Ausserdem fuhren sie seit Mitte der Achtziger Jahre jedes Jahr an ihre Lieblingsküste; ein Unterbruch dieser Tradition wäre wohl auch ein Unterbruch ihrer bürgerlichen Konstante.

Waldmeyer wusste jedoch: Die Costa Corona konnte kein guter Ort sein im Jahr 2020. Und so kam es, wie es kommen musste: Sondereggers Ferien wurden zum Albtraum. Dabei hatte alles gut begonnen. Die Buchung klappte, der frische Coronatest steckte in der Tasche, die Vorfreude war dieses Jahr besonders ausgeprägt.
Die Maskentragpflicht in der Lobby des Hotels störte Ursula nicht: „Siehst du, die tun was!“ Dass am ersten Tag kein Platz am Strand war, störte nicht weiter. Es galt eh einzukaufen, denn Waldmeyer hatte ihnen geraten, sich vorsichtigerweise gleich bei der Ankunft einen Notvorrat anzulegen.
Am nächsten Morgen standen sie schon um 05:30 beim Eingang zum Strand. Beim Ein- und Ausgang musste Maske getragen werden. Vernünftig. Es lohnte sich, so früh aufzustehen, denn bereits um 06:00 sperrten die bis an die Zähne bewaffneten Carabinieri (schwarzer Mundschutz) auf. Das „Buongiorno“ klang etwas höhnisch, aber Sonderegger schaute grosszügig darüber hinweg: „Die sind immer so.“
Die 120 Euro Eintritt waren gerechtfertigt, wie sich bald herausstellen sollte. „Weisst du noch, Reto, früher kostete es 20‘000 Lire!“
Pierino händigte die in Plastik verschweissten Badetücher aus, wies ihnen den Plastikkubus zu und desinfizierte die Liegen. „Il tuo slot è dalle 9.25 alle 09:35!“ Er meinte damit den Sondereggers zustehenden Kurz-Slot, um im Meer zu baden. „Siehst du, Reto, sie lassen uns trotzdem rein!“, triumphierte Ursula. Waldmeyers Warnungen waren damit obsolet.
Bald kippte jedoch die Stimmung. In dem Plastikverschlag herrschte nämlich bereits um 08:00 eine Affenhitze. Inzwischen stand die Ampel beim Strandeingang bereits auf Rot, und es hatte sich eine dichte Schlange davor gebildet. Die Leute unterhielten sich jedoch munter und laut. Italianità eben.
Die Lautsprecher am Strand plärrten ohne Unterbruch. Es folgten wichtige Corona-Durchsagen im Minutentakt. Ursula versuchte auch dies als Italianità zu werten.
Sondereggers verzichteten auf die eingeschweissten dürren Panini mit der dünnen Salamischeibe, welche Pierino dienstfertig und maskenbewehrt von Kubus zu Kubus schleppte. Sie kosteten nur 8 Euro, das Aqua Panna in der Glasflasche ebenso. Reto hatte vorsorglich und glücklicherweise bereits einen weiteren Slot fürs Mittagessen gebucht, erster Durchgang um 11:05. Das war sehr angenehm, denn so konnte man dem kochend heissen Plastikgefängnis schon bald entfliehen. Man musste anschliessend auch nicht mehr zurück an den Strand, der Eintritt verfiel mit dem Verlassen der Zone.
Auf dem Balkon im Hotelzimmer war es eh kühler, und schon bald konnte an den Slot fürs Abendessen gedacht werden.
Ursula analysierte zu Recht: „Der Conte hat zwar gesagt, dass die Italiener diesen Sommer nicht auf dem Balkon verbringen müssen. Aber Balkone sind doch auch ok, nicht?“
Sonderegger entgegnete ebenso messerscharf: „Ja, der Conte hat schon recht. Die meisten Italiener werden den Sommer nicht auf dem Balkon verbringen, weil sie gar keinen Balkon haben.“
Waldmeyer nahm den Sonderegger-Bericht in der folgenden Woche mit Genugtuung entgegen und meinte nur: „Schön, seid ihr schon früher zurück! Kommt Ihr heute Abend zum Grillieren in unseren Garten?“
Sondereggers Augen leuchteten.
______________
Merkwürdige Covid-19-Mutanten: Waldmeier lüftet das Geheimnis
Waldmeyer stellte fest, dass die Pandemie-Massnahmen sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Er konnte sich diesen Sachverhalt nicht anders erklären, als dass die Covid-19-Viren einfach nicht alle die gleichen sein konnten. Es handelte sich mit Sicherheit um besondere Stämme mit spezifischen Eigenschaften – oder um Mutationen, denen eben situativ und insbesondere ländermässig der Garaus gemacht werden musste. Der eine Virentyp scheint die Masken problemlos zu umkurven, der andere verliert jegliche Power beim Einfliegen in eine Kita oder beim Landen auf einem Filetstück in der Metzgerei. Waldmeyer versuchte es mit einer Auslegeordnung.
In Südkorea schien es sich um eine ganz harmlose Mutation gehandelt zu haben. Covid-19-kimshi scheint eine ziemlich flügellahme Sub-Variante zu sein. So konnte sie mit ein paar konzertierten Isolationen, Quarantänen, viel Random-Testing und den Tracing Apps in Schach gehalten werden. Ein paar Bars mussten geschlossen werden, ansonsten keine Lockdowns. Der Schaden für die Wirtschaft konnte in Grenzen gehalten werden. Ähnlich in Singapur. Leider hatte man dann aber dieses gemeine Covid-19-hospes vergessen, das nur die Gastarbeiter attackierte – ein kleiner Regiefehler.
Interessant schien Waldmeyer Covid-19-clericus: ziemlich harmlos, deshalb wurden auf den kanarischen Inseln schon sehr bald die Kirchen wieder geöffnet, während andere Sub-Stämme, offenbar mit ganz anderen Eigenschaften, den Rest der Gegend noch heimsuchten.
Rätsel bereitet der Wissenschaft eine fiese US-Kopie des Virus: Covid-19-ethnic attackiert offenbar gehäuft dunkelhäutige Menschen. Vorerst fiel in den USA jedoch Covid-19-trampus auf, völlig lendenlahm – das wurde immerhin vom Präsidenten persönlich bestätigt. Aber das Virus mutierte plötzlich zum böse grassierenden Covid-19-sinica, offenbar gezielt aus China ausgesetzt, welches insbesondere übergewichtige Amerikaner angreift (also eigentlich fast alle Amerikaner). Es wird jetzt erfolgreich mit Desinfektionsmitteln bekämpft – oral oder durch direkte Injektion. Ja, dies selbstredend mit Empfehlung des Präsidenten. Die US-Viren sind so oder so Sonderfälle, zumal sie auch politische Eigenschaften aufweisen: Die schwächere Sub-Variante ist republikanisch, die gefährlichere demokratisch.
In Frankreich hat sich die DNA von Covid-19 so verändert, dass dieses mutationsunfähig geworden ist: In allen Landesteilen verhält es sich gleich, weshalb es ganz elegant mit zentralistischen Methoden von Paris aus bekämpft werden kann. Also auch dort, wo es sich gar nicht befindet! Covid-19-figaris wird dabei als brandgefährlich eingestuft: Coiffeure bleiben deshalb bis auf weiteres geschlossen, alle Einzelhandelsgeschäfte gingen jedoch aber bereits auf. (Die helvetische Sub-Mutation war relativ unbedenklich, weshalb die Figarogeschäfte als erstes wieder aufsperrten.)
In UK erfolgte die Erstentdeckung von Covid-19-britannicus gleich durch den Premierminister höchstpersönlich. Dessen Selbstversuch mit einem darauffolgenden coronitten Gang ins Spital entfesselte zumindest die eigentliche Virusbekämpfung. Die britische Covid-Untergruppe der Viren in den Altersheimen (Covid-19-senilis) wurde indessen nicht bekämpft, man liess es am Leben, die Senioren allerdings nicht. Eine ähnliche Viren-Untergruppe wurde offenbar auch in Italien, Spanien und Frankreich nicht bekämpft.
Aus Übersee trafen noch weitere Meldungen von merkwürdigen Virus-Mutationen ein. Der WHO bereitete zum Beispiel Covid-19-bolsonarus Sorgen: Die Behörden in Brasilien verleugnen nämlich dessen Existenz. Oder in Panama wundert man sich über die merkwürdige sexuelle Ausrichtung des Virus: Je nach Wochentag befällt es entweder nur Frauen oder nur Männer – ein Phänomen. Auf Mauritius wütet Covid-19 besonders stark: Zwar sind erst gut zehn Leute verstorben, aber aufgrund der überdurchschnittlich eingeschätzten Gefährlichkeit der mauritianischen Mutation kommen alle künftigen Besucher eines Lebensmittelladens erst einmal in den Genuss einer Ganzkörper-Desinfektion, indem sie einen speziellen Tunnel vor dem Laden durchqueren müssen. Wer es schafft, darf einkaufen. In Dubai bestand ein ganz anderes Problem: Eine äusserst rare Corona-Spezies barg die Gefahr einer Selbstinfektion. Deshalb mussten Autofahrer, selbst wenn sie sich alleine im Fahrzeug befanden, ebenso eine Maske tragen.
In Deutschland schien sich das Virus in Niederfrequenz-Läden über 800m2 schneller zu verbreiten als in kleinen Läden. Es handelte sich offenbar um die seltene Art des Covid-800-inversus. Ausserdem haben die länderspezifischen Covid-19-Varianten gelernt, genau an den Landesgrenzen Halt zu machen. Für die Behörden galt also bis vor kurzem nicht, nach Hotspots zu suchen, sondern einfach aufzupassen, dass man die Ländergrenzen nicht überschreitet (um nicht in einen anderen Virenstamm zu geraten). Die Viren sind wie die Deutschen sehr obrigkeitshörig: Sie wissen nämlich haargenau, wo die Grenzen sind.
In der Schweiz mutierte das Virus gemeinerweise – ähnlich wie in Deutschland – in genau 26 Untervarianten, welche deshalb auch mit 26 kantonalen Strategien bekämpft werden müssen. In den Zürcher Kitas zum Beispiel scheint der Virus Covid-19-agoraphobie zu wüten. In der Folge dürfen die Kita-Leiterinnen keine Maske tragen. Begründung: Die Kinder könnten erschreckt werden. Waldmeyer wollte diese absurde behördliche Anordnung erst gar nicht glauben und hakte nach. Aber sie stimmte tatsächlich!
Völlig ungefährlich sind übrigens die helvetischen Viren bei Thekenverkäufen: Die Bäckersfrau und der Metzger dürfen deshalb ungeschützt über die Auslagen husten. Schweizer Fleisch ist eh besser als das ausländische, das haben wir aus der Werbung gelernt. Unser Fleisch ist wohl auch immun gegen Covid-19-carne.
Eine weitere, aber völlig unbedenkliche eidgenössische Mutation wurde im April beobachtet: Covid-10-tatoodos. Nur so war zu erklären, dass die Tatoo-Studios, deren Besuche offenbar staatstragende Bedeutung zukam, als erstes wieder geöffnet werden konnten – während das heimtückische Covid-19-electronicus die Wiedereröffnung von Mediamarkt verunmöglichte. Diese Covid-Viren weisen in der Tat eine verblüffende Varietät aus – ansonsten würde man ihnen nicht so differenziert zu Leibe rücken.
Besonders fies scheint Covid-19-maturandis zu sein. Es handelt sich um eine Sub-Gattung der kantonalen Sub-Covids und scheint ausschliesslich Maturanden zu befallen. Es ist derart gefährlich, dass die schriftlichen Maturaprüfungen nicht einmal in einer grossen Turnhalle abgehalten werden können. Auch mündliche Prüfungen sind nicht möglich: Das Virus würde selbst Glas- oder Plexiglasscheiben durchdringen! Die betroffenen Schulabgänger werden ihr CV künftig verstecken müssen, ihr Maturadatum 2020 stigmatisiert sie mit einem entwerteten Abschluss. „Aha, Sie haben eine Corona-Matura gemacht?!“, wird man Waldmeyers Neffen Philipp Kohler anlässlich eines Bewerbungsgespräches bei Ernst & Young im Jahre 2025 vorwerfen. Ein Jammer.
Waldmeyer kam langsam ans Ende seiner Reflexionen und resümierte, dass es doch viel einfacher wäre, wenn diese Viren weltweit in unveränderter Form auftreten würde. Dann könnten sie auch in einer konzertierten gemeinsamen Aktion bekämpft werden. Vielleicht sollte er eine Eingabe bei der WHO machen – dieser schien es ja an Ideen zu fehlen, sie hatte sich während der ganzen Pandemie merkwürdig still verhalten.
Ein Nachtrag noch:
Die Firma Apple zumindest scheint weltweit von einem identischen Virus Covid-19-malum befallen zu sein und handelt deshalb auch koordiniert: In allen Apple Shops weltweit werden Masken getragen und Fieber gemessen. Waldmeyer lief es plötzlich kalt den Rücken runter: Hoffentlich schaut dort demnächst kein Zürcher Kita-Kind rein – es wäre bestimmt fürs ganze Leben traumatisiert.
________________
Waldmeyers Wertung der Corona Kredite
Waldmeyer hatte es befürchtet: Bruno Spirig, sein Cousin, drehte wieder ein krummes Ding. Das mit dem Take-away in Schwamendingen, finanziert mit Lieferantenkrediten, war von vornherein hoffnungslos gewesen. Allerdings hatte Bruno schon früher immer ein bisschen windige Projekte. Das neue jedoch verblüffte Waldmeyer: Bruno beantragte für seinen Laden in Schwamendingen tatsächlich einen Coronakredit. Nicht, dass sein Cousin hoffte, damit den Take-away über die Runden zu bringen. Nein, es ging ihm eher um die willkommene Liquidität, mit der er ganz andere Pläne hatte.
Waldmeyer bereute es, seinem Cousin früher einmal einen Tipp gegeben zu haben, wo er jemals komfortabel untertauchen könnte – vorausgesetzt, dass dies wieder einmal notwendig sein sollte. Falls er zum Beispiel wieder mit dem Gesetz in Konflikt geriete oder pleite ginge (wie in den 90-er Jahren, als er nach Brasilien verschwand). So hatte ihm Max kürzlich geraten, nach El Huerro zu verschwinden, eine kleine, ziemlich unbekannte Kanareninsel. Das Eiland von der Grösse des Kantons Appenzell Ausserrhoden wäre ein idealer Rückzugsort, um nicht gestört zu werden – und dies bei wirklich bescheidenem Budget. Man wäre in Europa, geografisch aber in Afrika. Lunch an Weihnachten im Freien bei 21 Grad, auf der Terrasse eines Eigenheimes, für das nicht mehr als Euro 1‘500 pro m2veranschlagt werden müssten. Die 11‘000 Einwohner verteilen sich gut auf der Insel, niemand stört. Nur mit Mühe würde man die AHV-Rente durchbringen.
„Max, ich werde mir eine kleine Villa auf El Huerro kaufen!“.
Waldmeyer wusste sofort, dass dies mit dem Einsatz des 0%-Coronakredits erfolgen musste. „Bruno, denk bitte nicht mal daran, diesen UBS-Kredit da zu platzieren, das geht einfach nicht!“
Bruno löste das Rätsel sofort auf und korrigierte: „Doch, doch, aber nur vorübergehend! Allerdings reicht der Kredit nicht. Ich konnte glücklicherweise bereits Anfang April gleichzeitig einen Kredit bei der CS, der Raiffeisenbank und der ZKB beantragen. Und alle vier haben sofort überwiesen! Da soll noch einmal einer sagen, die Banken und der Ueli Maurer seien langsam! Der UBS-Kredit alleine wäre für die Villa zu knapp gewesen. Aber ich habe kein schlechtes Gewissen, denn Ueli nimmt das Geld doch zu 0% Zinsen auf, nicht? Ich könnte auch Fussballer oder Klavierspieler sein, die erhalten jetzt ja noch mehr – richtig?“
Waldmeyer reflektierte: Es stimmte, eigentlich kostet Geld heute nichts. Wenn der Kredit nach fünf Jahren im April fällig wird, wird Ueli Maurer pensioniert sein und vielleicht ebenso auf den Kanaren weilen; er wird sich dann allerdings wohl kaum um die Kreditausfälle kümmern. Die Bürgschaftskosten kämen dann alle auf einmal beim Bund rein, alle im April 2025. Waldmeyer fragte sich, ob sich für diesen Zeitraum überhaupt jemand als Finanzminister zur Verfügung stellen würde. Inzwischen hätte sich Bruno Spirig einiges aufgebaut auf El Huerro. Er würde wohl zu den ganz wenigen Investoren gehören, und mittels Multiplikatoreffekt könnte er den Wohlstand auf der Insel mehren. Wer weiss, vielleicht würde ihm dann gerade im April 2025 eine Statue auf dem Dorfplatz gewidmet. Bruno el suizo, libertador de El Huerro. In der Summe, so resümierte Waldmeyer, war sein Cousin gar nicht so kriminell. Es kam ja niemand zu Schaden (vielleicht eine spätere Generation nur, mit einem nanomässig erhöhten Schuldenberg des Bundes). Bruno Spirig war eher ein Robin Hood, hervorgegangen aus Corona, indirekt gefördert von Herrn Draghi, dem Geldvermehrer.
________________

Waldmeyers Erfahrung als Darth Vader
Der Entscheid stand fest: Sobald die Restaurants wieder öffnen, wird ein Tisch gebucht. Aber man würde sich vorsehen müssen, denn Social Distancing und alle weiteren Massnahmen sollten beherzigt werden. Charlotte hatte vorgesorgt, indem sie zwei teure FFP2 Masken organisiert hatte. Mattschwarz, als Interior Designerin war sie das der Sache geschuldet.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Der Abend verlief nicht ganz nach Plan. Denn schon auf der Fahrt ins Tre Fratelli hatte Waldmeyer ein komisches Gefühl: Er schwitzte unter der Maske und hatte Angst, von der Polizei angehalten zu werden. Wie war das schon wieder mit dem Vermummungsverbot?
Vor dem Restaurant begrüsste Luigi auf Distanz. Auch das Layout drinnen war plötzlich auf Distanz getrimmt. Die auseinandergestellten Tische gaben dem Lokal etwas Hallenähnliches, fast wie in einem Fellini-Film. Waldmeyer hatte sich früher immer gefreut, wenn sein Tisch noch nicht frei war, denn so konnte er unter dem Deckmantel des Wartenmüssens einen Extra-Aperitif an der Bar geniessen. Jetzt war die Bar mit einem roten Absperrband versperrt. Am Tisch kam ebenso wenig Atmosphäre auf, Waldmeyer murmelte etwas von „Charme einer ungeheizten Kathedrale“. Die aufgestellten Plexiglas-Barrieren, zum Teil nahe an den Tischen, trugen auch nicht sonderlich zur Stimmung bei. Charlotte fand es indessen cool, die Bestellung gleich mit dem Pager vom Tisch aus durchzugeben. Die langfädigen und mit viel Gestikulieren untermauerten Erklärungen Luigis zum Menü entfielen damit. Auch beim Servieren blieben die überflüssigen und edukativen Erklärungen aus.
Die Speisekarte war stark verkleinert. Und das gewählte Saltimbocca war teuer, auch etwas trocken. Charlotte plädierte für Nachsicht, die Küchencrew müsse ja erst mal wieder richtig in Fahrt kommen. Das mit der Maske war jedoch ein selbst verschuldeter Fauxpas: Waldmeyer hatte sich schon beim Betreten des Lokals als Darth Vader gefühlt und gleich erkannt, dass kaum jemand eine Maske trug (ausser ein paar Angestellte). Es war offensichtlich, dass man dergestalt kaum Nahrung aufnehmen konnte. Burkaträgerinnen können ein Lied davon singen.
Im Lokal wurde den ganzen Abend nur geflüstert. Das war früher nie so. Waldmeyer verzichtete auf den Grappa, zumal jetzt das Plexiglas schmolz, da die Kerzen zu nahe standen. Zeit, den Heimweg anzutreten.
Auf der Rückfahrt war es im Auto ebenso ruhig wie zuvor im Restaurant. Das lag nicht am hervorragend schallisolierten Porsche Cayenne (schwarz, innen auch). Sondern an der Stimmung. Bis Charlotte mit einem verwegenen Vorschlag die Stille durchbrach: „Warum kaufen wir uns nicht einen neuen Backofen? Weisst du, mit dieser digitalen neuen Steuerung, da kann gar nichts mehr schiefgehen.“
Waldmeyer, vom Terre Brune angenehm alkoholisiert, blieb stumm. Aber er sinnierte: Verändert sich jetzt das Konsumverhalten nachhaltig? Alle diese neuen Backöfen, einmal angeschafft, müssten ja amortisiert werden. Die Gastronomie könnte also noch weiter leiden.
__________________

Waldmeyers Maskenproduktion als nano-ökonomischer Ansatz
Waldmeyer war zu Beginn der Pressekonferenzen mit Daniel Koch vom BAK (Bundesamt für Krankheit) ziemlich beeindruckt: diese Ruhe, diese Unaufgeregtheit, klare Fakten, don’t worry. Waldmeier fiel dabei der zurzeit oft verwendete Begriff der „Übersterblichkeit“ ein. Ja, auch Daniel Koch strahlte mit seinem etwas morbiden und über-ruhigen Habitus gerade etwas Übersterbliches aus. Das ganze Pandemie-Management (es betrifft den Bundesrat und das BAK) bestach indessen nicht nur durch Ruhe – im Gegenteil, es wurde immer irrlichternder; die wirren Informationen und Entscheide betrafen unter anderem auch die Masken.
„Max“, meinte Charlotte, „es wird Zeit, dass wir die Maskenproduktion selbst in die Hand nehmen.“ „Hervorragend“, meinte Max, „wir brauchen aber erst mal Stoffe!“ Charlotte wusste wohl bereits, dass ihr Gatte über ein paar überflüssige weisse Hemden verfügte. Seit der Homeoffice-Periode war klar, dass er nur noch einen Bruchteil davon sinnvoll einsetzen könnte.
Waldmeyer war mental sofort dabei. Einfach als homo oeconomicus, zudem war er mikroökonomisch gestählt – und prompt hatte er auch gleich einen Plan. Er überschlug kurz, dass sich mit seinen 50 Hemden (er würde nahezu alle opfern) genau 1‘350 Masken produzieren liessen. Er entschied sich für die N95 Norm. Nach einiger Übung könnten sieben Minuten Produktionszeit pro Maske veranschlagt werden. Wenn er sich zuhause voll für die Küche einsetzen würde, traute er Charlotte einen 12-Stunden-Tag zu. Mit zwei kurzen Pausen könnten also täglich 100 Masken produziert werden, mit Samstagarbeit 600 in einer Woche. Die Masken könnten im Wholesale – da hervorragende Qualität – vielleicht für vier CHF verkauft werden. Macht ca. CHF 2‘400 Wochenumsatz, brutto. Enttäuschend. Das war nicht mal Mikroökonomie, eher schon Nanoökonomie.
„Charlotte, wir kommen da nirgends hin. Wir brauchen mehr Leverage. Wir sollten mit dem Asylantenheim im Nachbardorf schauen und eine Produktionsausweitung planen. Die meisten Frauen aus diesen Ländern sind doch Näherinnen, nicht?“
Was Waldmeyer noch nicht wusste: Charlotte wollte eigentlich nur zwei Stück zur Überbrückung nähen, bevor ihre Online-Bestellung endlich geliefert würde.
________________
Negativer Preis für Benzin
Waldmeyer hatte gestern einen abscheulichen Albtraum: Jemand klopfte an die Türe seiner chicen Villa in der näheren Umgebung von Zürich und fragte, ob er 100 Kanister Benzin reinbringen könne. Gratis. Natürlich wollte ihn Waldmeyer sofort rauswerfen. Aber der versierte Verkäufer kam ihm zuvor, denn er offerierte ihm CHF 100 für die Abnahme. Cash, und zwar pro Kanister! Das heisst, er wollte ihm 100 Kanister auf sein gepflegtes Eichenparkett wuchten und dafür auch noch bezahlen. Offenbar musste er die Ware einfach loswerden, koste es, was es wolle. Und er war bereit, noch CHF 10‘000 drauf zu geben.
Waldmeyer, durchaus ein homo oeconomicus, schoss kurz die Idee durch den Kopf, dass er damit ein Geschäft machen könnte. Oder doch besser alles in die Garage runterzutragen und dort eine persönliche Reserve halten? Die 2‘000 Liter würden für seinen Porsche Cayenne (schwarz, innen auch) für knapp 20‘000 km reichen – immerhin.
Aber Waldmeyer lehnte ab. Zu umständlich, es war den Preis einfach nicht wert. Der durchaus eloquente und elegant gekleidete Verkäufer liess jedoch nicht locker, er erhöhte den Preis. Schrittweise, immer höher. Waldmeyer dachte an Charlotte, wenn sie die 100 Kanister im Living entdecken würde. Bei welchem Preis würde er jetzt wohl einknicken? Bei CHF 100‘000 vielleicht?
„Bei einer halben Million bin ich dabei!“, rief Waldmeyer. Charlotte schreckte aus dem Schlaf auf: „Was meinst Du, Max?“. Nun war auch Max hellwach. „Es ging sozusagen um eine Spende, Charlotte, schlaf weiter!“
Waldmeyer erinnerte sich an den Film „Indecent Proposal“ mit Robert Redford. Jedes Angebot hat wohl eine Schmerzgrenze. Irgendwann wird fast jeder schwach. Morgen wird Waldmeyer seinem Sohn die Geschichte mit den Kanistern erzählen und ihm Mikro- und Makroökonomie erklären.
25.4.2020
________________
Die Wahrheit: warum Coiffeure first
Geht es nur um Karin, Simonetta und Viola?
Waldmeyer ist überzeugt, dass es bei den jüngsten Lockerungsentscheidungen den Frauen im Bundesrat ganz eigennützig um die Bewältigung von hinlänglich persönlichen Probleme ging. Karin hatte nämlich seit Tagen mit ihren (eher auffälligen) Strähnchen ein Frisurproblem, Violas kompakt frisiertes Haupthaar durfte ihr Walliser Coiffeur nicht in Ordnung bringen, und Simonetta fiel auf, weil sie in den letzten Tagen wohl selber zur Schere gegriffen hatte.
Ueli und Alain blieben mit ihren Frisur-Wünschen selbstredend aussen vor. Eines war jedoch sicher: Die Schliessung der Coiffeurgeschäfte hatte sich sehr schnell zu einem nationalen Problem ausgebreitet. Die Eckpfeiler unseres Staatswesens drohten einzustürzen.
Unsere drei Protagonistinnen vermissten übrigens auch ihre Kosmetiksalons (Pedicure war vielleicht dringend nötig bei Simonetta, Manicure bei Karin, Gesichtspflege bei Viola).
Zudem wollte Simonetta ihrer Mutter Blumen schicken lassen. Und Violas Cousin, ebenso im Wallis, so wurde kolportiert, stand mit seinem Gartencenter kurz vor der Pleite. Es ging nichts mehr. Fundierte Entscheide mussten her.
Und so kam es denn, dass in dem kleinen, rührigen Land der Möbelhändler mit dem Niederfrequenzkonzept (auf der grünen Wiese) geschlossen blieb, das Tatoostudio in der Innenstadt aber wieder öffnen durfte.
Simonetta freut sich drüber: Sie braucht keine Möbel, ihr Pied-à-terre in der Bundestadt ist zwar nicht sehr geschmackvoll, aber mehr oder weniger vollständig eingerichtet. Sie besitzt abgesehen davon gar kein Auto, um zum Möbelhändler zu fahren. Dafür könnte sie nun ihren geheimen Tatoowunsch erfüllen. Niemand weiss, wo sie den Schmetterling anbringen wird. Und sie selber weiss bedauerlicherweise auch nichts von der Geschichte des „Flügelschlag des Schmetterlings“ – denn sonst wüsste sie, dass die unselige Lockerungspolitik des Bundesrates mittels negativer Multiplikatoreffekte dominoartig immense Schäden verursacht.So oder so: Es sollte den Kleinen geholfen werden. Die gehen sonst unter. Die grossen ausländischen Konzerne werden überleben. Waldmeyer ärgert sich, denn die Damen haben zwar ein gutes Herz, aber leider kein gutes Big Picture vor Augen.
23.4.2020
_________________
Die irre 10er Bande
Welches sind die extremsten, peinlichsten oder gefährlichsten Leader im Jahr 2020?
Hier Waldmeyer’s Rangliste mit den 10 irrwitzigsten Staatsmännern der Welt.
Für einmal gegliedert nach Unterhaltungswert.

RANG 1: Boris Johnson
Geläutert nach seinem coronitten Spitalaufenthalt wird er ebenso witzig und flamboyant wieder ins Politbusiness einsteigen. Boris zeichnet sich durch scharfen Intellekt, Energie, aber auch Populismus aus. Zuweilen liegt er völlig falsch, vertuscht aber immer schlau und mit unglaublichem Selbstvertrauen. Erfrischend unkonventionell in Haartracht und Stil, beissende Reden, bester englischer Humor. Schadenspotential für UK wohl nicht zu gross, Unterhaltungswert jedoch sehr hoch!
RANG 2: Kim Jong-Un
Der letzte richtige Diktator und Tyrann eines kommunistisch geprägten Landes lässt nichts aus: Er führt ein gnadenloses und staatskapitalistisches Unregime, begeht Menschenrechts-verletzungen und ordnet eigenhändig Morde an. Seine Schulbildung in der Schweiz, die er u.a. im bernischen Köniz genoss (Notendurchschnitt 4 = knapp genügend), konnte auch nicht verhindern, den letzten vollkommen abgeschotteten und verarmten Staat der Welt nun ins Desaster zu führen.
Relativ hoher Unterhaltungswert – nur schon Haarschnitt und Garderobe sind bemerkenswert.
RANG 3: Recep Tayyip Erdogan
Der selbsternannte Autokrat zeichnet sich durch hohe Unberechenbarkeit aus – er macht, was er will. Seine Staatsvisionen sind bar jeder ökonomischen Grundkenntnisse und geprägt von Megalomanie (sein neuer Palast beherbergt 1‘000 Zimmer). Seine verdeckt-islamistischen Visionen sind gefährlich (harmlos dagegen, dass Madame Erdogan übrigens zwei Kopftücher übereinander trägt). Der de facto Despot führt das Land mit selbstherrlicher Hand, allerdings politisch und wirtschaftlich ins Abseits. Der alte Atatürk würde sich im Grabe umdrehen. Erdogans Reden haben einen überdurchschnittlichen Unterhaltungswert, insbesondere unsynchronisiert auf Türkisch.
RANG 4: Donald Trump
In hohem Masse erratisch, arrogant, populistisch, eingebildet (leidet an chronischer Selbstüberschätzung), hohe Beratungsresistenz, zum Teil irrlichternd, frauenverachtend, hohes Moraldefizit. Lügt nachgewiesen und mit bemerkenswerter Konstanz, grosser Anhänger der einfachen Sprache. Grösste intellektuelle Leistung: Erfinder der „alternative facts“. Sein Marketingtalent ist unbestritten, denn er ist einerseits ein Selbstvermarktungsgenie, andererseits vermag er auch Nichtexistentes zu vermarkten. Mittlerer Unterhaltungswert, da zu viele Wiederholungen. Für aufgeklärte Europäer eher beschämend. In Sachen „share of voice“, also quasi sein Marktanteil in den Medien, klar auf dem Podest.
RANG 5: Rodrigo Duterte
Stark zufallsgesteuert (ein „unguidedmissile“), Licence to kill, verblüffende Durchsetzungskraft, erstaunlich brutal, kompensiert mangelnden Intellekt sehr raffiniert mit Schläue. Ziemlich hoher Unterhaltungswert, wenn teilweise auch an Peinlichkeit grenzend.
RANG 6: Nicolas Maduro
Der selbstherrliche venezolanische Busfahrer erhält den ersten Preis für das rascheste Runterfahren einer Wirtschaft. Mit seinen pro forma sozialistischen und abstrusen Ideen hat er es geschafft, das Land mit den weltweit grössten Erdölreserven im Eiltempo in den Ruin zu treiben. Das soll noch einer mal schaffen, einfach so eine Inflation mit 200‘000% hinzukriegen. Verstaatlichungen, Despotentum, Repression, Killertruppen, Verschwörungs-theorien – das ganze Arsenal an Repression und „Unstaatwesen“ wird bedient. Maduro führt eine korrupte Nomenklatur an, welche via Drogenhandel und verdeckte Auslandguthaben schon längst vorgesorgt hat. Für Eingeweihte haben seine mehrstündigen Reden einen immerhin mittleren, wenn auch traurigen Unterhaltungswert.
RANG 7: Jair Bolsonaro
Ein begnadeter Populist, ehemaliger Hauptmann mit bescheidener ziviler Ausbildung. Geringes Mass an staatsmännischen Fähigkeiten, grossspurig, sexistisch, arrogant (verbunden mit einem erstaunlichem Mass an sozialer und wirtschaftlicher Blindheit). Hoher Realitätsverslust, sehr einfache Visionen. Unterhaltungswert gering, eher erschreckend.
RANG 8: Narendra Modi
Intelligent, aber gefährlich kastendenkend und rassistisch; grosses Talent, die selbsternannte grösste Demokratie der Welt sehr undemokratisch zu führen. Unrealistische Visionen, lebt komplett asketisch. Ziemlich unberechenbar, entscheidet wenig nachhaltig. Ein Spaltpilz. Unterhaltungswert nur hoch, wenn er englisch spricht.
RANG 9: Vladimir Putin
Es wird vermutet, dess er die reichste Person der Welt ist. Putin führt das best-organisierteste korrupte Regime der Welt. Ausgesprochener Machthunger, Erfinder und grosser Förderer der manipulativen Internet-Trolls und der modernen hybriden Kriegsführung („wir waren es nicht“). Der ehemalige UdSSR-Agent ist wohl der intelligenteste Leader im Club, brand-gefährlich, destabilisierend. Auftritte allerdings eher langweilig, Unterhaltungswert gering (Ausnahme: Putin mit nacktem Oberkörper auf Pferd).
RANG 10: Viktor Orban
Ausgesprochen selbstgefällig, stark autokratisch handelnd und planend, antisemitisch, populistisch. Hält zwar die Finger auf offensichtliche Defizite der EU, profitiert indessen kräftig von deren Hilfen. Hohe manipulative Fähigkeiten. Meister in der Produktion von Verschwörungstheorien („Soros untergräbt die Welt“), gefährlich. Niedriger Sympathiewert, kein Unterhaltungswert.
RESERVEPOSITIONEN
Unter Beobachtung, da noch unklarer Unterhaltungswert:
- Lukaschenko (Weissrussland)
- Al Khamenei (Iran)
- Yoweri Musevemi (Uganda)
- Daniel Ortega (Nicaragua)

