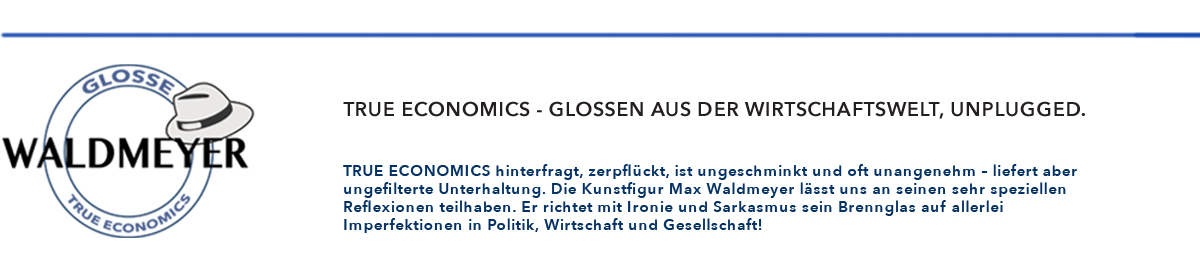Die Politik und der Bundesrat hecheln hinter dem Verlauf der Gegenwart hinterher. Erstarrt in der Geschichte, wird die Neutralität nicht nur überzeichnet, sondern auch falsch interpretiert. Waldmeyer wird dem Bundesrat nun unter die Arme greifen.
Die aktuelle militärische Krisenlage in Europa hat überhaupt nichts mit jener der früheren zu tun: Im Zweiten Weltkrieg war das mit der Neutralität noch ganz praktisch. Zwischen direkten grossen Nachbarländern eingeklemmt, wollten wir keine Fehler begehen und entschlossen uns deshalb – richtigerweise – „neutral“ zu bleiben. Allerdings verhielten wir uns überhaupt nicht neutral. Das war nämlich unser Geheimnis: Wir taten nur so. Noch bis 1944 liessen wir ungehindert deutsche Transporte mit Waffen und Munition durch die Schweiz passieren. Erst 1945, als das Scheitern der deutschen Wehrmacht voraussehbar war, wurde die Schweiz etwas restriktiver – nicht zuletzt aufgrund des erhöhten Drucks der Alliierten auf die Schweiz. Unsere „Neutralität“ im Zweiten Weltkrieg war letztlich somit keine echte, es handelte sich eher um ein opportunistisches und wechselhaftes Abseitsstehen. Das war durchaus erfolgreich – aber nicht ehrlich, und unsere damalige Positionierung darf schon gar nicht mit hehrer und friedensstiftender Neutralität beweihräuchert werden.
Dass sich Christoph Blocher heute der armen jungen Russensoldaten erbarmt, die in der ukrainischen „Sonderoperation“ sterben, zeugt nicht von Empathie, sondern von einer perversen einseitigen Wahrnehmung. Die schrecklichen Gegebenheiten rund um den russischen Angriffskrieg sollten nämlich auch dem alten und rückwärtsgewandten Populisten bekannt sein, wird in den westlichen freien Medien doch täglich darüber berichtet. Die Gruselliste der Vergehen ist nur schwer verdaulich, der Leser darf sie auch überspringen:
Es handelt sich um vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung, Ausbombung ganzer Städte, detaillierte Zerstörung von Siedlungen, gezielte Angriffe auf Schulen, Spitäler und andere zivile Infrastrukturen, Folter und Erschiessen von ukrainischen Soldaten, aber auch von Zivilpersonen, geplante sexuelle Missbräuche von Männern, Frauen und Kindern, Verschleppung von Zivilpersonen und insbesondere Kindern nach Russland, Geiselnahmen und Vertreibung von Millionen von Bürgern, Einsatz von geächteten Waffen (wie Streubomben), Verminung und Vernichtung von Getreidefeldern, Diebstahl von Millionen Tonnen von Getreide, Plünderungen, etc.
Kurzum: Verstösse gegen alle Regeln der Menschenrechte und Menschlichkeit. Es sind tausende von einzelnen Kriegsverbrechen. Den Haag müsste die Juristische Infrastruktur bedeutend ausweiten, um allen diesen Verbrechen nachzugehen und sie zu ahnden. Waldmeyer ist der Meinung, dass nun unverzüglich man mit dem Bau eines neuen grossen Traktes mit Gefängniszellen begonnen werden sollte.
Fazit: Das Neutralitätsverständnis von vielen Bürgern und Politikern ist nicht nur überzeichnet, sondern wird ganz einfach fehlinterpretiert. Irgendwo hört es nämlich auf, „neutral“ zu bleiben. Darf man, wenn solche Vergehen mitten in Europa stattfinden, wirklich „neutral“ bleiben? Nein, man darf nicht. Eine falsch verstandene „Neutralität“ würde uns sogar schuldig machen.
Neutralität darf es nur im Rahmen zivilisatorischer Grenzen geben. Russland hat diese überschritten und ist jetzt ein Pariastaat.
Die Wahrheit betreffend der Neutralitätsdiskussion ist eine andere, so Waldmeyers Zwischenbilanz, die er sofort mit Charlotte teilte: „Tatsächlich geht es um die wirtschaftlichen Interessen der Schweiz, und die Neutralität war und ist immer nur ein Werkzeug dafür.“
Stellen sich denn Magdalena und Christoph – und auch Roger Köppel – in der Tat vor, dass, wenn wir die Sanktionen gegen Putins autokratisch regiertes Unregime nicht mittragen würden, Gas und Strom wieder ungehindert und günstiger nach Helvetien fliessen würden?
Letztlich sollten wir uns der Spieltheorie bedienen, wie es Waldmeyer schon früher tat, als es um die Erklärung des Phänomens des Toilettenpapier-Mangels ging. Wie beim Schachspiel müssen die nächsten Züge immer antizipiert werden. Was wäre also, Zug um Zug, passiert, wenn wir die Sanktionen nicht unterstützt hätten? Als erstes wäre der Druck der EU und der USA auf uns gestiegen. Bei Mangellagen hätten wir, so der nächste Zug, mit Bestimmtheit keine grosse Unterstützung aus Europa erhalten. Wir sind nämlich, dies im Gegensatz zu vielen Ansichten im Volk (befeuert von unseren bekannten populistischen Einpeitschern) ein kleines Mosaiksteinchen nur in einem grossen Ganzen. Das betrifft Güter, Dienstleistungen, Energie, Sicherheit, etc. Unser Land ist heute, im 21. Jahrhundert, ein Land der kompletten Vernetzung und Abhängigkeit – und nicht mehr ein Land der Autarkie.
Doch zurück zur Spieltheorie: Die USA hätten unser Finanzwesen mit Strafbestimmungen überziehen können. Und Gas wäre immer noch keines geflossen.
Doch wie stehen denn Länder da, die keine klare Position gegen Russlands krassen Bruch mit dem Völkerrecht bezogen haben? So die Türkei, Serbien, Indien oder Südafrika? Die Antwort ist klar: Sie stehen nicht gut da und geraten unter westlichen Druck. Diese Staaten tragen die Sanktionen allerdings nicht mit, weil sie schon immer mit Russland sympathisierten – und nicht, weil sie sich „neutral“ verhalten wollen. Hätte die Schweiz nicht Position bezogen, würde sie sich jetzt in die Phalanx dieses zweifelhaften Clubs einreihen.
Wieso öffnen gewisse Politiker denn nicht die Augen? Waldmeyer meinte erst: Seelig die Dummen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er reflektierte aber nochmals und erkannte, dass dem nicht so ist, zumindest nicht, was die führenden Rechtsaussen-Politiker betrifft. Dort herrscht nicht verzeihbare Dummheit, sondern raffinierter Populismus. Neutralität, stammtischabgestimmt, verkauft sich gut. Und bei grösseren Problemen hätte man, gegenüber dem Ausland, immer noch einen grossen Trumpf auszuspielen: Man könnte doch einfach den Gotthard sperren!
Waldmeyer stellte fest: Unsere Neutralitätspolitik ist offenbar Innenpolitik – und nicht Aussenpolitik. Die Aussenpolitik wird nur vorgeschoben: Glauben denn unsere Rechtsaussen-Protagonisten tatsächlich, nicht Position beziehen zu müssen, um Friedensverhandlungen zwischen den Kriegsparteien führen zu können? Waldmeyer nimmt diesen Putinverstehern schlichtweg nicht ab, dass sie an solchen hehren Friedensmissionen tatsächlich interessiert wären.
Wenn es schon darum ginge, Sicherheitspolitik für das Land zu betreiben, so müsste man sich klugerweise eh auf die Seite der Stärkeren schlagen. Und die Stärkeren sind nun mal die westlichen Staaten, mit denen wir moralisch, kulturell und wirtschaftlich verbunden sind. Gerade auch das Letztere müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen: Dieser drastisch überschätzte russische Staat erzielt doch tatsächlich nur ein Bruttoinlandprodukt (in USD), welches kaum mehr als doppelt so gross ist wie das der Schweiz! Waldmeyer weiss, dass dieser verbliebene riesige Staat der Sowjetunion eigentlich nur Gas, Öl und Hackerdienstleistungen exportiert, wir hingegen feinen Käse, leckere Schokolade und edle Uhren. Ja, natürlich auch Maschinen und vor allem chemische und pharmazeutische Produkte, aber die sind für unser Image weniger von Belang. Die Konsequenz also: Russland ist ein lächerlich kleiner Absatzmarkt, nur noch ein zur Tankstelle Chinas verkommener Staat, und wenn wir die Energieabhängigkeit von Putins Reich einmal ganz abgeschüttelt haben, müssen wir gar nicht mehr so tun, als ob wir neutral sind!
Der Bundesrat ist einmal mehr überfordert. Er möchte es allen recht machen – insbesondere allen politischen Parteien, und er möchte in so delikaten Dingen wie „Neutralität“ am liebsten gar nicht Position beziehen. Leider kann der Bundesrat dieses ärgerliche Thema nicht an die Kantone delegieren. Er versuchte es bei der Pandemiebekämpfung, zurzeit wieder im Management von möglichen Strommangellagen. In Sachen Ukraineüberfall funktioniert das leider nicht. Also wurstelt er sich durch, getrieben von allerlei Druck von der Innenpolitik und von der EU und den USA. Kein Wunder, sind da vor allem die zuständigen Bundesratsdepartemente, vertreten durch den Winzer aus der Westschweiz und den Onkologen aus dem Tessin, heillos überfordert.
„Also wenn die Chinesen Taiwan überfallen, wäre ich klar für Taiwan“, so Waldmeyers Statement gegenüber Charlotte, welche er nun wiederholt bei der Lektüre irgendeines dicken Buches störte. „Das geht aber nicht, Max, wir müssten neutral bleiben!“, entgegnete Charlotte – meinte es allerdings eher sarkastisch.
„Stimmt“, entgegnete Waldmeyer, „der Blocher wäre dann auch wieder gegen Sanktionen, weil Magdalena sonst vielleicht irgendwelche Produkte nicht mehr von China erhielte.“
Ja, so läuft das eben mit dem Vehikel „Neutralität“: Es geht nicht um politische und moralische Positionsbezüge – sondern nur um ziemlich kurzfristig gedachte Handelspolitik, verpackt in volksnahe Stammtischsprache.
Wie sollte denn unsere Neutralität künftig definiert werden? Waldmeyer macht dem Bundesrat hier und jetzt einen Vorschlag: Die Schweiz sollte hinter einer strengen „westlichen Neutralität“ stehen. So einfach und zielführend ist das! Das Adjektiv „westlich“ ist der Schlüssel. So kann die Schweiz unverfänglich Position beziehen gegenüber allem, was „nicht-westlich“ ist.
„Ja, schreib das dem Cassis, Max!“, meinte Charlotte und hoffte, das Thema so nun abschliessen zu können.