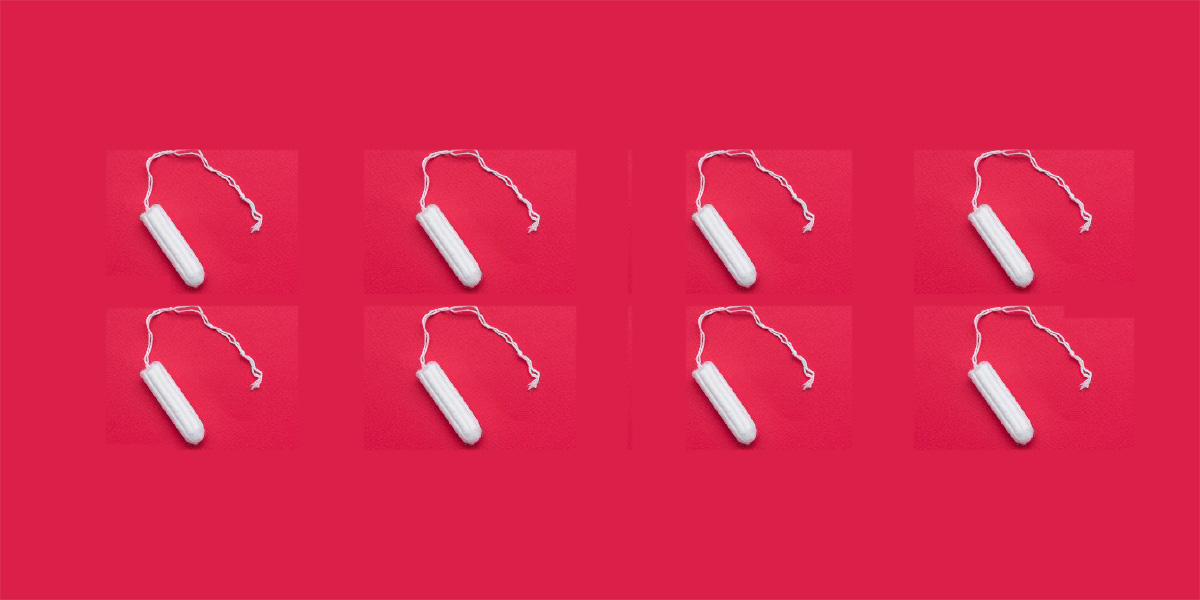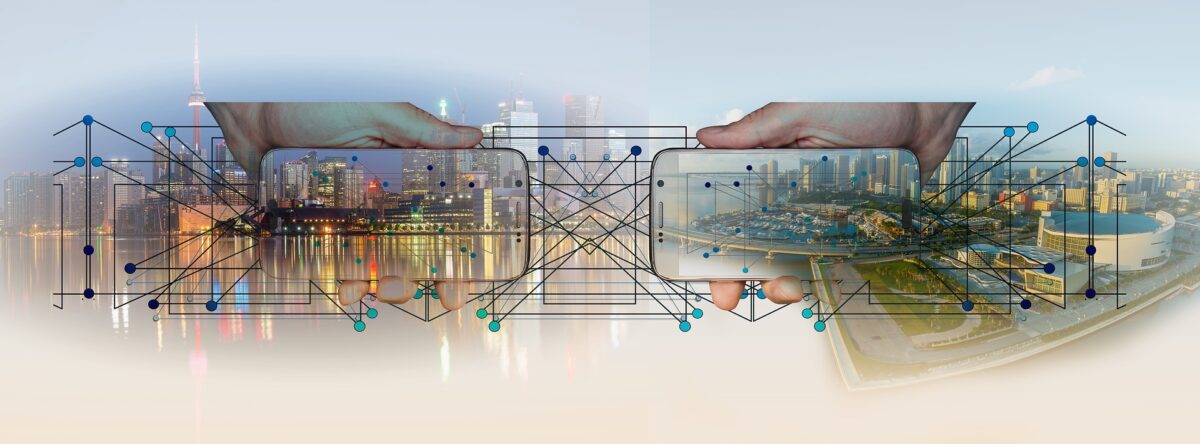In ganz Europa fehlt es allenthalben an Fachkräften, insbesondere in Deutschland und in der Schweiz. Sollten wir nun einfach mehr gut ausgebildete Ukrainer einstellen? Oder die Sechs-Tage-Woche wieder einführen? Waldmeyers Analyse und Ideen sind leider nicht alle sozialverträglich.
Noch bis vor kurzem verkündeten selbsternannte Soziologen, Philosophen und auf Abwege geratene Ökonomen, dass uns die Arbeit ausgehen werde. Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung würden uns die Jobs stehlen. Und die Künstliche Intelligenz würde dann zum endgültigen Aus für Arbeit für alle führen. Die durch KI befähigten Roboter würden alles erledigen, wir wären dem Nichtstun ausgesetzt und würden folglich ökonomisch und sozial verkümmern – ausser wir würden uns in intrinsischen neuen Werten wiederfinden. Also müssten wir schon jetzt, in dieser heiklen Übergangsphase, alle weniger arbeiten, und ausserdem müsste dringend ein unabdingbares Grundeinkommen geschaffen werden. Was allen diesen Prognosen und Ideen allerdings fehlt, ist eine Lösung, wie diese wunderbare neue Work-Life-Balance denn finanziert werden soll. Einer der wenigen Kulminationspunkte in Sachen Finanzierung war die Begründung der NMT (der New Monetary Theory), welche für diesen Umbruch eine staatliche Finanzierung bis zum Abwinken vorsah – weil Schulden einfach ewig produziert werden könnten, ohne sie jemals abbauen zu müssen. Die gleiche Theorie sah auch kein Inflationsproblem mit der ausufernden Gelddruckerei. Nun ist es merkwürdig still geworden um die lauten Protagonisten dieser NMT.
Die Geschichte zeigt, dass Prognosen in Sachen Arbeitsverteilung aufgrund von Technologiesprüngen eh immer falsch lagen: Schon die Erfindung der Eisenbahn, der Elektrizität oder der modernen Industriefertigung führten letztlich, in der Summe, zu keiner Arbeitsvernichtung – sondern nur zu einer Veränderung der Arbeit. Insgesamt blieb der Bedarf an Arbeitskräften gleich. Die Einführung der elektronischen Datenverarbeitung und die flächendeckende Verbreitung der PCs kreierten ganze Felder neuer Tätigkeiten.
Waldmeyer erinnerte sich, wie in seiner Firma das „papierlose“ Büro, welches sein IT-Chef prognostiziert hatte, zur Makulatur verkam. Generell wurde noch nie so viel Papier produziert und verbraucht wie heute. Und der Headcount in Waldmeyers Firma stieg damals trotz „EDV“ laufend.
Die Gründe, warum es zu unserem aktuellen Defizit an Fachkräften gekommen ist, sind vielfältig. Vordergründig liegt die Erklärung ganz einfach in der Mathematik, der Demographie: Die Babyboomer gehen in Rente, und es fehlt an nachkommenden Arbeitskräften. Unsere Gesellschaft ist hoffnungslos überaltert. Waldmeyer lief es kalt den Rücken hinunter bei der Vorstellung, dass auch er schon bald in dieses Cluster der nichtarbeitenden Senioren gedrängt werden könnte.
Aber es gibt noch andere Gründe für diesen Fachkräftemangel: Der Wohlstand und die Doppelverdiener-Möglichkeiten führen zu vielen Einzelentscheiden, nur noch Teilzeit zu arbeiten. Insbesondere junge, gut ausgebildete Leute fahnden nach einer optimierten Work-Life-Balance: Man möchte möglichst gut verdienen, möglichst im Homeoffice arbeiten und möglichst nicht zu 100%. Die Schuld am Fachkräftemangel liegt also nicht nur bei der älteren lendenlahmen Generation, welche in Sachen Kinderkriegen glatt versagt hat, sondern auch bei der jüngeren, welche weniger arbeiten möchte.
Waldmeyer formulierte es so: Wir sind zu unserem eigenen Wohlstandsopfer geworden! Ja, und auch die Gewerkschaften sind schuld, denn diese versuchen die Arbeitszeiten laufend runterzubringen, verhindern Sonntagsarbeit, erschweren die Arbeit für grenzüberschreitende Dienstleistungen, usw. So fehlen natürlich wertvolle Arbeitsstunden. Doch Lamentieren bringt nichts, Lösungen sollten her. Waldmeyer gab sich Mühe, das Thema nun zu entpolitisieren.
Aber gerade darin lag die Krux: Wie sollte beispielsweise das gerechte Renteneintrittsalter definiert werden? Was sollen wir den Jungen Grünen erklären, welche eine 24-Stunden-Woche fordern? Dürfen wir es überhaupt noch wagen, eine Sechs-Tage-Woche anzudenken?
Man könnte die Lösung auch bei sich selbst suchen. Beim Einzelnen – und somit im grossen Ganzen. Wenn jeder für sich selbst bessere Arbeitslösungen findet, könnte ein optimiertes Gesamtkonzept entstehen. Wieso also sollte Waldmeyer nicht ein paar Stunden mehr arbeiten pro Woche? Waldmeyer entschuldigte sich indessen gleich selbst, weil er sich nicht als „Fachkraft“ sah. Als Unternehmer – oder Ex-Unternehmer – sah er sich eher in einer etwas übergeordneten Rolle, schliesslich war es immer an ihm, Fachkräfte einzustellen. Und zudem, so reflektierte er weiter: Wenn er sich wieder vermehrt unternehmerisch betätigen würde, würde er die Auslösung eines weiteren Bedarfs an Fachkräften provozieren und die ganze Misere nur verschlimmern.
Waldmeyer blickte von seiner Terrasse in Meisterschwanden auf den Hallwilersee runter und fühlte sich darin bestärkt, doch besser Ex-Unternehmer zu bleiben. Ja, nur schon aus gesellschaftspolitischen Gründen.
Also analysierte er weiter. Das Problem lag nämlich, unter anderem, auch bei der allgemeinen Arbeitsquote: Wieso arbeiten in der Schweiz die Männer im arbeitsfähigen Alter nur zu rund 80%? Und noch schlimmer: Wieso die Frauen gar nur zu knapp 70%? Genau, hier liegt ein ungeheures Potential brach! Die meisten Frauen in der Schweiz verfügen über eine Berufsausbildung – fast alle haben nämlich, gefühlt, das KV gemacht, wie Waldmeyer schon früher feststellte. Die könnte man sofort vermehrt einsetzen.
Intelligente Lösungen findet man oft, indem man ins Ausland schaut. Aber man findet hier auch viele abschreckende Modelle, wie man es nicht machen sollte. So hatte die 35-Stunden-Woche in Frankreich letztlich zu einer nicht mehr wettbewerbsfähigen Industrie geführt, oder die Vier-Tage-Woche von VW einen Mangel an zeitlich optimierter Versorgung mit Fachkräften provoziert. Die sozialistisch verbrämte Idee, vermeintlich mangelnde Arbeit auf mehr Köpfe zu verteilen, hat sich fast überall als Rohrkrepierer erwiesen. Geboren wurde die Idee auf der Basis von hoher Arbeitslosigkeit, wobei leider nicht berücksichtigt wurde, dass das Grundübel dieser Arbeitslosigkeit oft in mangelnder Ausbildung lag – oder falscher Ausbildung, welche der Nachfrage der Wirtschaft gar nicht entsprach.
Und damit sind wir schon beim dritten Punkt, welcher zu diesem Fachkräftemangel führt: Die Schweizer Jugend möchte keine handwerklichen Berufe mehr ergreifen. Waldmeyer dachte zum Beispiel an seine Tochter Lara, welche seit Jahren in Basel Kunst studiert– anstatt, auch nur beispielsweise, schon lange als Zahntechnikerin zu arbeiten. Die extrem hohe Rate an Universitätsabgängern in Italien oder Spanien beispielsweise hilft nicht weiter, wenn es an Kellner, Pflegerinnen, Elektriker (Elektriker*innen?) oder Klempner fehlt.
Waldmeyer forschte weiter nach Lösungen: Das mit dem mangelnden Nachwuchs kann man nicht mehr kompensieren. Es verhält sich so wie mit den heute fehlenden Stauseen und Pumpspeicherkraftwerken, die wir gerade jetzt für die Energieversorgung bräuchten: Man hätte eben 20 Jahre vorausdenken sollen. Solche Fehler lassen sich nicht mehr kurzfristig korrigieren.
Folglich, so führte Waldmeyer sein singuläres Brainstorming fort, müssen wir die Lösung notgedrungen wohl im Ausland suchen, im Import von mehr Arbeitskräften. Also z.B. mehr Ukrainerinnen und Ukrainer?
Die USA, Kanada, Australien, Neuseeland oder neu auch UK definieren jährlich einfach den genauen Bedarf an Berufen, und mittels Punktesystem wird dann die Immigration gesteuert. Das funktioniert ganz leidlich. Neuseeland könnte für 2024 z.B. 300 Elektriker im Ausland bestellen.
Das Gegenteil war wohl das „Wir-schaffen-das-Konzept“ von Angela Merkel: Eine fast ungehinderte Einwanderungspolitik mit Arbeitskräften, die nicht der Nachfrage entsprach oder die sich kulturell nie integrieren werden. In Schweden finden in den Ghetto-Vororten zurzeit regelrechte Bandenkriege zwischen schwer integrierbaren Einwanderer aus oft fremden Kulturkreisen statt. Immigration, welche nicht der Nachfrage entspricht, ist keine Lösung. Das hat nichts mit einer Abkehr von einer humanitären Haltung zu tun, sondern mit einer konsequenteren Verhinderung der Immigration von Wirtschaftsflüchtlingen: Wenn diese nicht in ein Bedarfsraster passen, gibt es tatsächlich keinen Grund, ihnen Asyl zu gewähren oder eine Niederlassung zu ermöglichen.
„Ich kann doch keinen tunesischen Hilfsmetzger in meiner Firma einstellen“, klagte Waldmeyer laut weiter. Pro memoria: Waldmeyer hatte diese erfolgreiche digitalisierte HLK-Firma aufgebaut, sich jedoch vor einiger Zeit aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Lukas Hartmann führt nun den Laden als CEO, Waldmeyer funkt indessen immer wieder dazwischen.
„Einen russischen Informatiker würde ich aber sofort einstellen“, ergänzte er. Charlotte überlegte kurz, ob sie antworten sollte. Beide könnten gefährlich sein, der IS-Metzger wie der Hacker-Russe.
Waldmeyer holte gleich weiter aus. Wir alle sollten wieder mehr arbeiten als die weit verbreiteten 40 Stunden pro Woche. Dann hätten wir sofort ein grösseres Arbeitspotential. „Das gilt nicht für mich“, warf Charlotte ein, „inklusive Hausarbeit arbeite ich bereits mehr als 44 Stunden.“ Für einmal war es Waldmeyer, der nicht antwortete. Trotzdem, dachte er, wären mit 44 Stunden 10% mehr Arbeitsvolumen zu realisieren. Man könnte dabei auch 10% mehr verdienen, das führt ja nicht zu Mehrkosten (denn die Einstellung von mehr Personal würde ebenso kosten).
Charlotte, wie wir wissen, arbeitet Teilzeit als Interior Designerin. „Du könntest etwas aufstocken, Charlotte, du bist eine Fachkraft, und das Land braucht mehr Fachkräfte“, sinnierte Waldmeyer laut weiter.
„Klar, könnte ich schon, Max“, antwortete Charlotte, nun sichtlich genervt, „aber wer macht dann deinen Scheiss-Haushalt? Du bräuchtest sofort eine Köchin, eine Wäscherin, eine Hilfe zum Einkaufen. Alles Fachkräfte. Und eine KV-Angestellte, um das Online-Banking zu erledigen!“
Waldmeyer überlegte kurz, ob das auch eine tüchtige, hübsche Ukrainerin erledigen könnte, behielt den Gedanken jedoch für sich.
Das Fazit aller Reflexionen war für Waldmeyer ernüchternd: Wir sind wohl selbst schuld, dass wir einen Mangel an Fachkräften haben. Wir werden zu alt, kriegen zu wenig Kinder, arbeiten zu wenig und zu wenig lange. Die junge Generation möchte nur noch für saubere Berufsausübungen im Homeoffice hocken und gleichzeitig sind wir nicht bereit, die richtigen Leute ins Land zu lassen.
Waldmeyer nahm sich vor, am Montag gleich mit Hartmann zu sprechen: In der Firma sollten nun sofort mehr gut ausgebildete, arbeitsbereite und integrationsfähige Ukrainer eingestellt werden. Die haben alle Freude an der Arbeit, die machen auch gerne mal Überstunden. Aber Deutsch sollten sie auch sprechen, ausserdem jung, freundlich und gesund sein. Und wenn möglich gut aussehen.