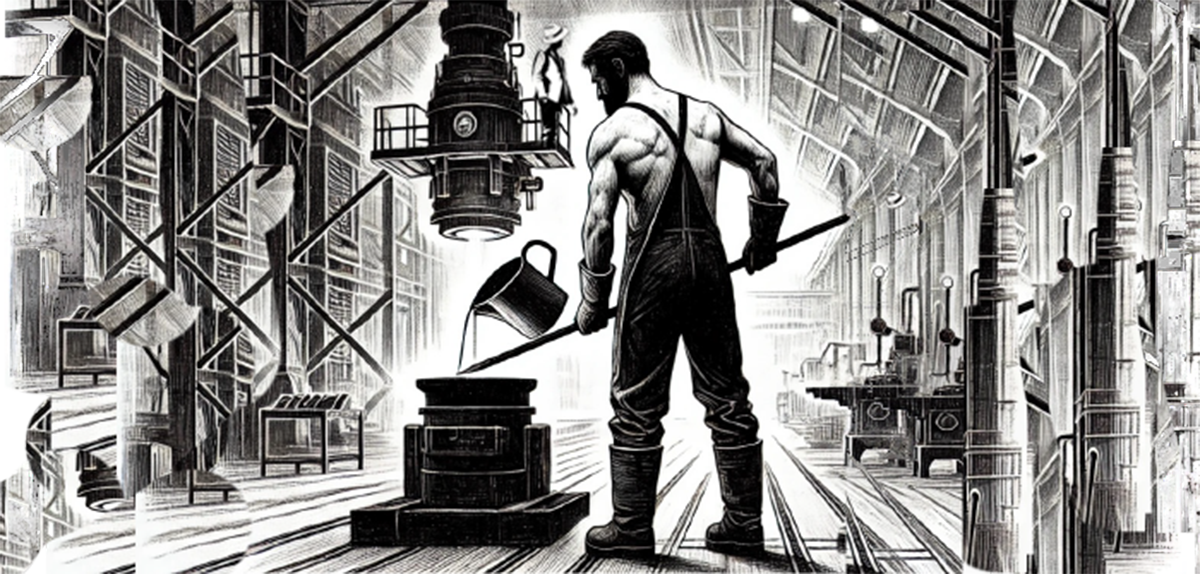Der Staat nimmt, der Staat gibt. Und wenn ein Problem auftaucht, muss es der Staat lösen. Diese Anspruchshaltung ist natürlich nicht neu, sie akzentuiert sich nur. Kein Wunder, machen Staaten immer mehr Schulden, während der Bürger mit immer weniger Eigenverantwortung leben darf. Zurzeit treibt die Hilfe nach dem Staat besondere Blüten: Der Staat soll nun bitte auch sicherstellen, dass wir unseren eigenen Schweizer Stahl produzieren dürfen!
Mittels Notrecht soll unsere Stahlproduktion der Swiss Steel im beschaulichen Gerlafingen gerettet werden, fordern verzweifelte Gewerkschafter, wohl in einem Anflug von geoökonomischem Weitblick. Die Wirtschaftskommission des Ständerates unterstützte das strategisch wertvolle Vorhaben vorbehaltslos, auch der Nationalrat, einem plötzlichen Helfersyndrom erlegen, sieht Handlungsbedarf. Selbst bürgerliche Politiker stehen hinter dem Ansinnen, hier werden die Argumente der «Kreislaufwirtschaft» bemüht, denn in den mit Sicherheit besonders sauberen Schweizer Stahlwerken soll Altstahl weiter zu neuem Stahl verarbeitet werden. Waldmeyer stellt sich die Frage: Ob der Bürger denn tatsächlich nicht weiss, dass eine solche Verarbeitung auch problemlos irgendwo im nahen Ausland in einem Dutzend bestehender Werke erfolgen kann?
Industriepolitik der Industriestaaten ist nichts Neues. Entweder wird gefördert, verhindert, verstaatlicht oder toleriert. Industriepolitik ist allerdings nur dort berechtigt, wo es um Sicherheit oder Systemrelevanz geht.
Der Schutz der schweizerischen Zuckerrübenproduktion zum Beispiel hat deshalb nur mit Nostalgie oder Stimmenfang in der Landwirtschaft zu tun. Der Staat unterstützt in diesem Fall den Absatz sogar werbetechnisch («Schweizer Zucker!»). Das machte er bis vor kurzem auch beim Fleisch («Schweizer Fleisch, alles andere ist Beilage!») Das waren bisher ganz lustige Interpretationen von Industriepolitik, so, wie sie die Schweiz eben versteht. Echte Industriepolitik betrieb sie bisher fast nie – ausser bei der Stromproduktion, der Wasserversorgung usw., also bei wichtigen staatlichen Dienstleistungen, die sich für ein modernes Land auch gehören. Dass die meisten Kantonalbanken staatliche Institute sind, ist allerdings bereits grenzwertig, und dass die Eidgenossenschaft eine Postbank betreibt und diese miserabel führt, ist gerade ein Beispiel, warum der Staat von solchen Vorhaben einfach die Finger lassen sollte.
Einmal wäre es vielleicht wichtig gewesen, dass man die Produktion unter staatlicher Kontrolle gehalten hätte: Es ging 2022 um den Erhalt der RUAG Munitionsproduktion. Anstatt an die Italiener zu verkaufen, hätte man die Manufaktur tatsächlich behalten können. Die Argumente «Systemrelevanz» und «Erhalt politischer Kontrolle» wären zu vertreten gewesen. Aber der Staat wollte nicht mehr, ausserdem waren die möglichen Auswirkungen des Ukrainekrieges in den Köpfen der Staatsführer noch nicht richtig angekommen. Also verhökerte man das Fabrikli.
Im nahen Ausland wird da ganz anders Industriepolitik betrieben. Bei Renault in Frankreich sitzt der Staat mit im Cockpit, er hockt auch in zahlreichen Redaktionsstuben diverser Medien, in Deutschland pfuscht das Bundesland Niedersachsen bei VW rein. Die italienische Fluggesellschaft wurde schon mehrfach durch den italienischen Staat gerettet und de facto übernommen. Und überall wird Hightech mit viel Geld angelockt. Die Schweiz war da bisher vernünftiger: Die Swiss beispielsweise überliessen wir grosszügigerweise den Deutschen. Und sie fliegt tatsächlich immer noch.
Kürzlich forderte die SP kurzerhand den Kauf von Sandoz (Marktwert: schlappe 15 Mia). Als ob gerade der Staat denn so einen Konzern besser führen und die Medikamentensicherheit nicht alternativ sichergestellt werden könnte – beispielsweise durch Pflichtlager etc. Das Ansinnen geriet denn auch, angesichts der Absurdität, schnell in Vergessenheit.
Und nun soll also die Schweizer Stahlproduktion gerettet werden. Zerfallende Strukturen sollen dem Untergang entzogen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Markt etwas braucht oder nicht. Swiss Steel muss nach eigenen Aussagen die Produktion einfach der Nachfrage anpassen. Hilft der Staat, in welcher Weise auch immer, die Arbeitsplätze zu erhalten, wird sich derselbe Staat damit von der Arbeit befreite Mitarbeiter in Gerlafingen leisten; sie haben dann nichts zu tun und warten auf einen Auftrag, um alsbald die Stahlkocher anzuwerfen. Sie spielen vielleicht Karten oder tauschen auf ihren Handys interessante TikTok Bilder aus, sie schleppen sich von Pause zu Pause und gehen dann um 16:30 erschöpft nach Hause. Vielleicht sind sie aber am Morgen gar nicht ins Werk eingerückt, denn neu könnten die Stahlarbeiter auch im Homeoffice bleiben. Piquet-Dienst, nennt sich das dann. Und anstatt zuhause online einen Umschulungskurs zu machen, Chinesisch zu lernen oder mit einem Physikstudium zu beginnen, lümmeln sie rum und ärgern ihre Ehefrauen.
Am Stammtisch, nach dem Beruf gefragt, geben sie bereitwillig Auskunft: «I bin Piquet, weisch.» Oder lapidar: «Homeoffice, weisch.»
So neu ist die Situation solch staatlicher Hilfe allerdings nicht. Die Landwirtschaft beispielsweise wird in der Schweiz jährlich mit Subventionen und anderen Beihilfen in der Höhe von rund fünf Milliarden bedacht. Jeder Schweizer Haushalt zahlt also durchschnittlich fast einen Tausender ein – die einen nichts, die andern sehr viel mehr. Zusätzlich bezahlen wir noch drauf, weil die landwirtschaftlichen Produkte in der Schweiz fast das Doppelte als im Ausland kosten, denn unser Land hat sich ja wunderbar abgeschottet, mit rekordhohen Zöllen, sodass unsere Bauern die Preise ebenso wunderbar hochhalten können. Das kostet im Schnitt etwa nochmals drei Tausender für jeden Haushalt zusätzlich pro Jahr. Also viertausend Stutz pro Haushalt jährlich für die Landwirtschaft. Den Mitarbeiter aus Gerlafingen trifft es damit besonders hart, denn in seinem Warenkorb befinden sich im Verhältnis zu seinen Gesamtausgaben viele Lebensmittel – nicht, weil er besonders viele Kalorien braucht am heissen Stahlkocher, sondern weil er einfach nicht so viel verdient. Einen Multimillionär trifft es dabei weniger hart, kann er doch auch nur dreimal essen pro Tag und dies mit Ausgaben, die er gar nicht spürt. Die Schweizer Landwirtschaftspolitik ist also etwas sehr Unsoziales. Waldmeyer nahm sich vor, dies einmal den Gewerkschaftsführer:innnen mitzuteilen – sollte er, aus irgendwelchem Grund auch immer, einmal eine solche Person antreffen.
In Sachen Landwirtschaft könnte es, mit den nötigen Sanierungsmassnahmen, auch günstiger gehen: Wir würden einfach etwas mehr importieren, könnten uns etwas weniger umweltversauende Landwirtschaft leisten und ein Teil der Bauern (welche sich zum Beispiel nicht eignen für eine Umschulung zu KI-Spezialisten) könnte Facharbeiter spielen, auf dem Bau oder so – die können nämlich in der Regel alles, diese Bauern, die sind ganz handy. In der Folge hätte a) der Staat (und damit der Steuerzahler) Geld gespart, b) der Bürger müsste weniger Geld für Nahrungsmittel ausgeben, könnte sich also anderes leisten und die Wirtschaft so ankurbeln, c) hätten wir etwas gegen den Facharbeitermangel getan und d) erst noch die eidgenössische Umwelt geschont, weil wir das Problem der Überdüngungen und der Methanproduktionen der Fleischwirtschaft kurzerhand outgesourcet hätten (nach Brasilien beispielsweise).
Aber zurück zu den Stahlkochern: Ein Grund für die Probleme des Schweizer Produktionsstandortes sind auch die Handelshemmnisse beim Export. Hier wäre tatsächlich positive Industriepolitik angesagt, Freihandelsabkommen und gescheite Verträge mit der EU unter anderem.
Aber letztlich verkommt es zu einem Witz, wenn wir im teuersten Land der Welt krampfhaft versuchen, im Primärsektor Strukturen aufrechtzuerhalten. Solche Industrien gehören nämlich in Schwellenländer, bestenfalls noch in wenig entwickelte Industrieländer (nach Serbien, beispielsweise). Stahl produzieren in der Schweiz…? Waldmeyer versuchte, sich dieses Ansinnen auf der Zunge zergehen zu lassen. Selbst wenn es Spezialstähle wären, besonders gute, schöne und exzellente Stahlprodukte, gar mit einem feinen Schweizerkreuz drauf: Die Bewahrung solcher Low-Tech Produktionen in unserem Land grenzt an ausgeprägte Sinnlosigkeit, man könnte ebenso gut eine Kaviar-Zucht aufziehen oder eine Mangofarm betreiben.
Ja, warum sieht der Staat bei diesen Dingen nicht einfach das Big Picture? «Der Bürger ist das Problem», warf Charlotte ein, «der macht auf «Switzerland first», ungeachtet der Kosten.» Charlotte hatte natürlich recht. Und eigentlich müsste man demokratischen Entscheiden immer recht geben. Aber was tun, wenn diese falsch gefällt werden…?
Nun, das mit der Landwirtschaft, das sah Waldmeyer ein, ist ein Sonderfall. Es ist ja auch nicht «Industriepolitik», sondern einfach eine Subventionierung eines offenbar «untouchable» Systems. Das mit der geplanten Unterstützung eines Stahlwerkes allerdings wäre ein ordnungspolitischer Sündenfall höchster Güte. Stahl kann auf der ganzen Welt eingekauft werden, die Idee gewisser Parlamentarier, in Sachen Stahl autonom zu werden, ist ein Ausdruck besonderer Weltfremde. Für einmal dürfen wir hier nicht einmal dem Bundesrat die Schuld geben, was Waldmeyer etwas bedauerte, sondern den Parlamentariern, notabene vom Bürger gewählte Abgesandte. «Der Bürger ist das Problem, Charlotte», fasste Waldmeyer zusammen. «Ich sags ja», seufzte Charlotte. Für einmal waren sich Max und Charlotte einig – was Waldmeyer doch etwas schade fand.