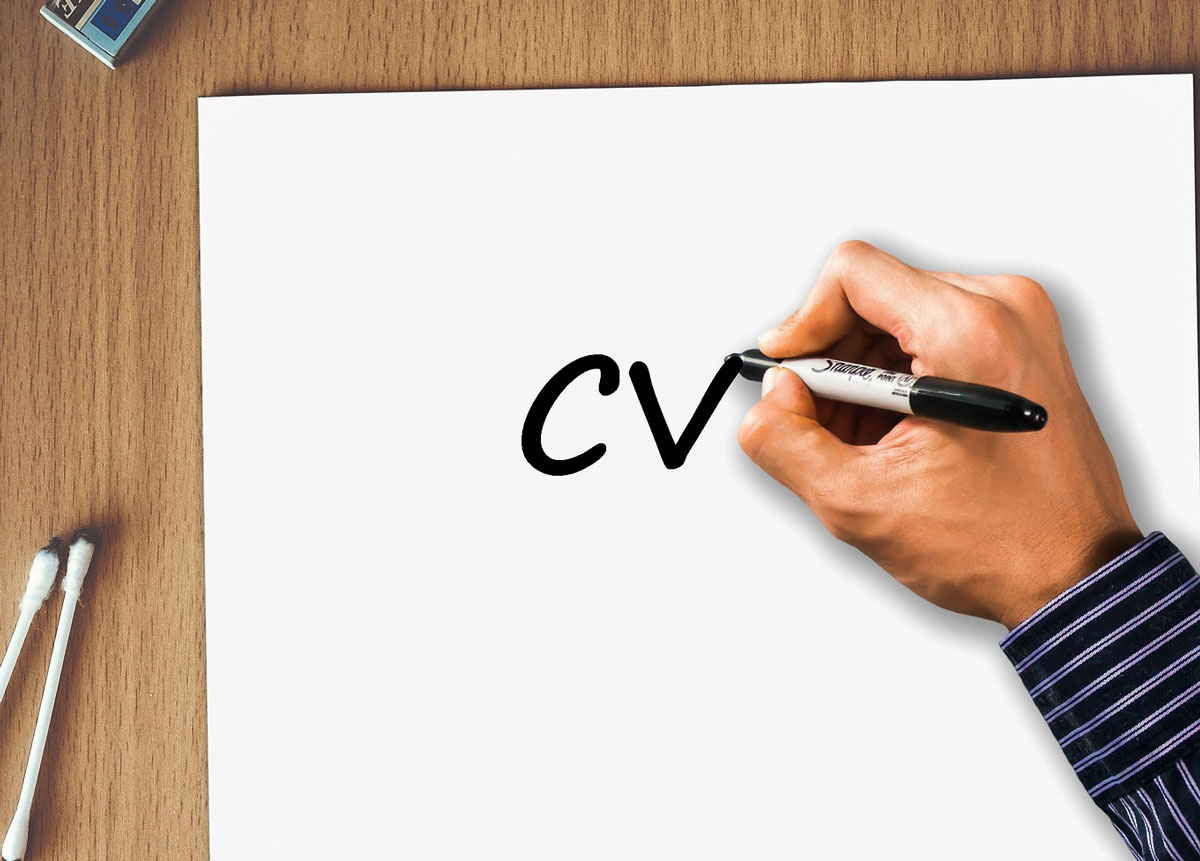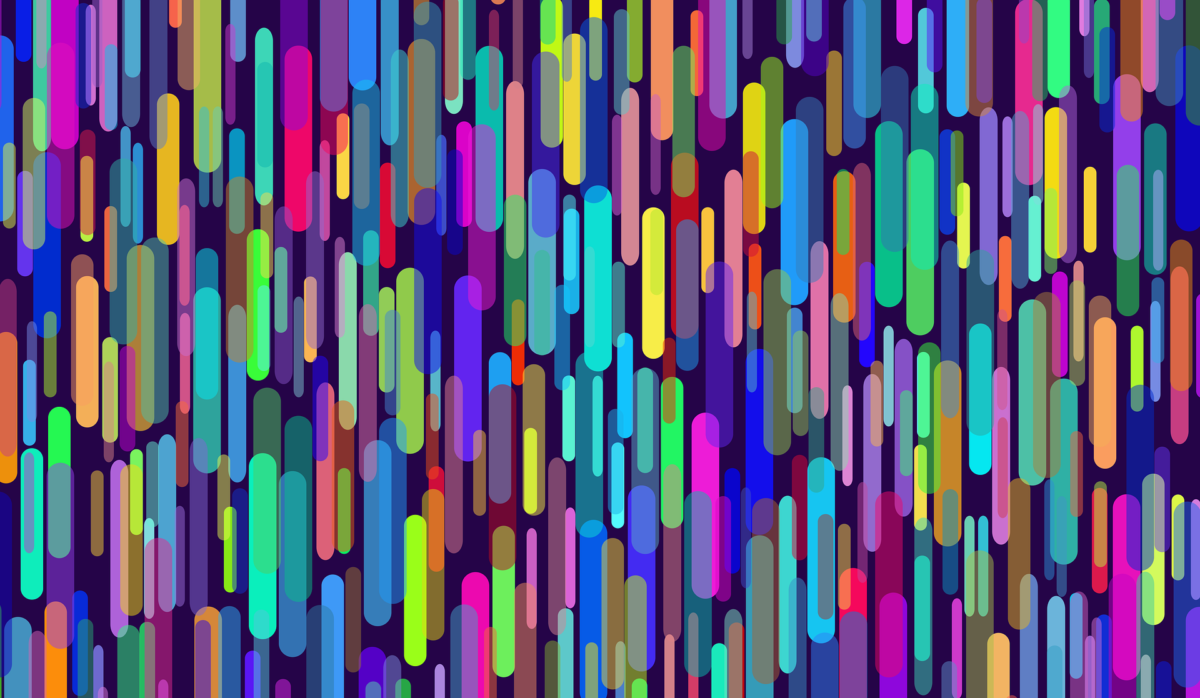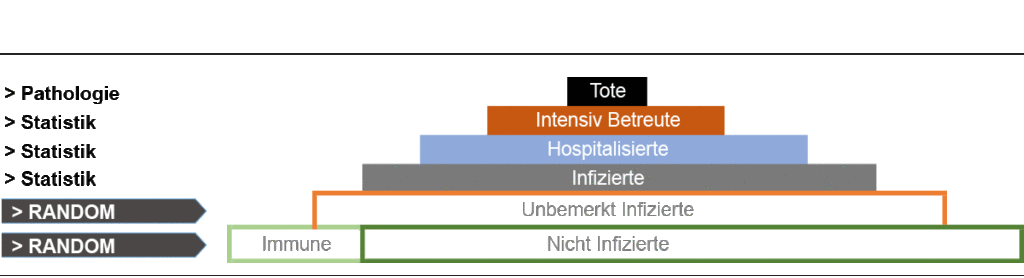Oder warum Waldmeyer Italien aufkauft
Waldmeyer beobachtete schon länger: Die Schuldenberge in Europa nehmen zu, und zwar in einem gigantischen Ausmass. Die italienische Schuldenquote beispielsweise stieg 2020 auf 159% des BIPs, die Spaniens auf 122%, Griechenland knackte die 200er-Marke. Irgendwie und irgendwo wurde offenbar Rettungspolitik mit Konjunkturpolitik vermischt. Und mittels Notenpresse werden de facto künstliche Einkommen erzeugt, Bürger und Firmen profitieren und erhalten Geld. Seit Lehman Brothers – Waldmeyer hatte nur einen Monat zuvor, im August 2008, seinen ersten Porsche Cayenne (schwarz, innen auch) gekauft – hatte sich die Euro-Geldmenge sage und schreibe versiebenfacht. Grund genug für Waldmeyer, sich eine neue Geldstrategie zurechtzulegen. Doch dazu später.
Waldmeyer, als ehemaliger Unternehmer soweit mikroökonomisch gestählt, fühlte sich plötzlich, zumindest was die Makroökonomie betraf, hilflos und leer. Das europäische Perpetuum mobile war einfach ein Rätsel: Die Schuldenexplosion bleibt nämlich ohne Folgen – es geht einfach weiter.
Italien erhält nun aus dem Corona Hilfsfonds über 200 Milliarden Euro. Premier Conte, jetzt zwar abgehalftert, war clever genug, sich quasi eine carta biancha auszuhandeln, wie er das Euro-Manna verwenden darf. Und nun ist es Mario Draghi vergönnt, dem ex EZB-Chef und wundersamen Geldvermehrer, diese 200 Euro-Milliarden zu verteilen – natürlich eine schöne Aufgabe.
Bereits fliessen drei Milliarden als frische Kapitalisierung in die neue Alitalia ITA ein – 12 Milliarden hat die seit Jahren marode Airline den italienischen Staat bereits gekostet.
12 Milliarden! Das entspräche, nur so zum Vergleich, rund 100’000 neuen, gut ausgestatteten Porsche Cayenne – was einer Wagenkolonne von Meisterschwanden bis nach San Gimignano gleichkäme. Schön viel, nur für eine Airline, zumal man mit den 100‘000 Porsches eine halbe Million Italiener transportieren könnte. Das Sümmchen von 12 Milliarden entspräche auch dem zehnjährigen BIP des Kantons Appenzell Innerrhoden (was Waldmeyer wiederum weniger schockierte, zumal der Minikanton über keinen Flughafen verfügt). Trotzdem: Die Kosten für solche Airlines scheinen gigantisch zu sein. Die Swiss wird auch noch ein paar Zuschüsse einfordern, reflektierte Waldmeyer weiter, ein Ende dieser Agonie scheint ebenso wenig in Sicht.
Aber zurück zum Bel Paese: Der italienische Staat übernimmt zurzeit weitere grosse Konzerne, so beispielsweise den maroden Stahlkonzern AM, mithin der grösste europäische Stahlkocher. An allen Ecken und Enden wird also verstaatlicht.
Auch bei Renault in Frankreich sitzt der Staat als Copilot in den mit viel Plastik bewehrten und schwer verkäuflichen Fahrzeugen. Nicht systemrelevante Firmen schlüpfen nun vermehrt, elegant getarnt mit Pandemiehilfen, unter staatliche Schutzschirme. Frau von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, sekundiert von Madame Lagarde, der Chefin der Europäischen Zentralbank EZB (sehr spendabel, wie der Vorgänger Draghi), zeigen sich grosszügig und verteilen Billionen. Richtig: echte Billionen, nicht nur die angelsächsischen mageren „billions“. Die beiden Damen scheinen zudem das stillschweigende Plazet von Mutti Merkel zu geniessen. Dieses feminine Triumvirat aus Nicht-Ökonomen scheint hier aus ökonomischer Sicht ein ganz toxisches Süppchen zu kochen.
Ja, da geschieht so einiges unter dem Deckmäntelchen von Corona. Allerdings bezahlen vor allem die Deutschen die Rechnung, plus die Holländer und die Skandinavier. Die Briten haben sich bekanntlich abgeseilt und beschäftigen sich nun lieber mit sich selbst.
Banken, Medienkonzerne, Werften, Energieunternehmen, Börsen, Fluggesellschaften: Viele Firmen und Konstrukte in Europa sind nicht mehr überlebensfähig. Und so werden diese Zombie-Konzerne verstaatlicht oder im besten Fall durchgefüttert. Allerdings torkeln auch im Privatbereich viele Zombie-Firmen durch die Wirtschaftswelt. Aber Banken statten sie einfach mit billigem Geld aus, welches sie gratis von ihren Zentralbanken erhalten. Letztere kaufen auch schon mal, mittels eigens geschaffenem Geld, diverse Werte direkt an der Börse zusammen. Und wie wir wissen, kauft die EZB auch fast unbegrenzt Staatsanleihen ihrer klammen Länder auf; vor allem die de facto wertlosen Papiere Italiens (welche magischerweise trotzdem mit 0.5% rentieren, was sonst nur supergesunde Staaten schaffen) wiegen derzeit etwas schwer in diesen illustren Portefeuilles der Zentralbanken.
La Cage aux Folles, besetzt mit den verantwortlichen Staatsdienern der Finanzwelt? Max Waldmeyer versuchte, dieses absurde Gebaren zusammenzufassen: Es wird also schier unbegrenzt Geld gedruckt und anschliessend gratis oder nahezu mit Nullzinsen in marode Wirtschaftszweige gepumpt.
Waldmeyer überlegte in der Folge, ob er nun ebenso umdenken und (beispielsweise nur) die Hotelbuchung in der Toscana stornieren sollte? Alternativ könnte er das Hotel nämlich einfach kaufen. Geld kostet ja nichts. In Dänemark wurden jüngst Hypotheken mit negativen Zinsen vergeben. Vielleicht liesse sich auch in Italien eine Bank finden, welche, auch nur beispielsweise, dieses hübsche Hotel Castello Rosato finanzieren würde, mit einer Hypothek von –0.25%. Waldmeyer hätte also ein regelmässiges Zusatzeinkommen – und dies aus einer Schuld! Plus das Castello natürlich.
Man könnte noch ein bisschen grosszügiger denken. Think big, mit einer gewissen römischen Grandezza eben: „Charlotte, vielleicht sollten wir ganz Italien kaufen!“, seufzte Waldmeyer vor sich hin.
Charlotte antworte, wie sie immer antwortete in solchen Fällen: nämlich gar nicht.