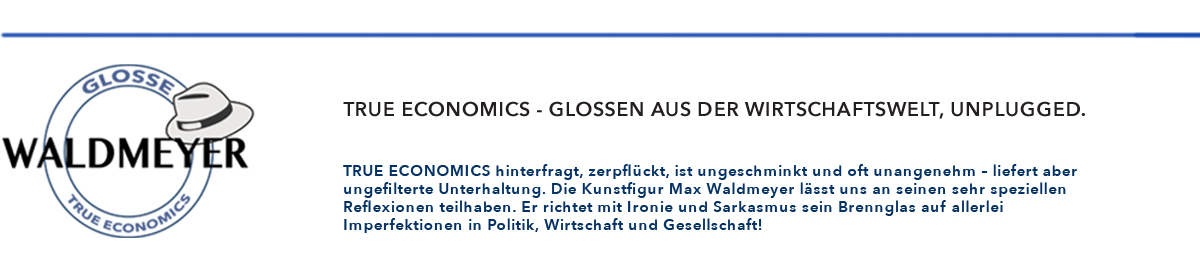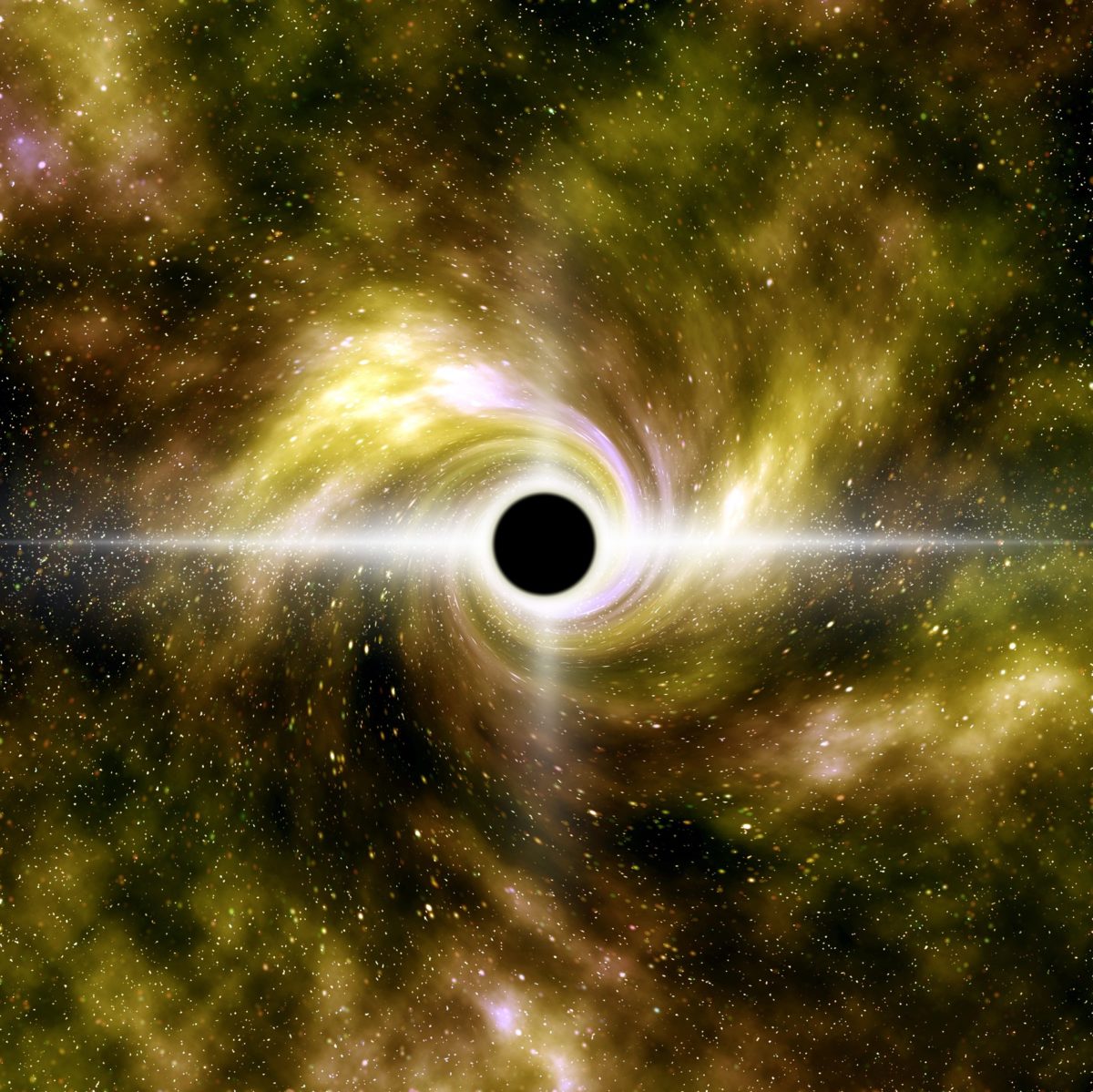Oder eben nicht… ?
Die Pandemiekrise hat nicht nur die Wirtschaft, sondern auch den Staat Milliarden gekostet. In den Staatskassen rund um den Globus tun sich riesige Löcher auf; die Verschuldungen steigen überall stark an. Einsparungen allein werden hier nicht viel bringen – also wird über neue Steuern nachgedacht. Auch in der Schweiz. Doch: Ist das wirklich nötig? True Economics meint: Nein, es wäre gerade falsch. Mit ein paar wenigen Ausnahmen vielleicht…
Teure Krise
Das Pandemiejahr 2020 wird ein grosses Loch in die Bundeskasse reissen. Die Hochrechnungen sind noch vage, jedoch werden es am Ende des Jahres wohl gut 20 Milliarden sein, die fehlen. Die Schweizer Staatsverschuldung wird damit von bescheidenen 40% (je nach Rechnungsweise) des BIP auf schätzungsweise gegen 50% steigen. Dazu müssen die Defizite der Kantone und Gemeinden dazugerechnet werden – deren Kassenwarte stochern noch im Nebel.
Der konsolidierte Rechnungsabschluss des Unternehmens Schweiz wird erst im Laufe des ersten Semesters nächsten Jahres vorliegen. Insbesondere die verringerten Steuereinnahmen werden vielleicht noch ein paar negative Überraschungen bringen.
2021 wird nicht besser
Massive Unterstützungsmassnahmen des Staates werden auch im nächsten Jahr fortgeführt, und die verringerten Steuereinnahmen werden sich auch im 2021 fortpflanzen. Das Staatsdefizit wird also nochmals steigen, denn ein ausgeglichenes Ergebnis ist wohl frühestens im Jahre 2022 zu erwarten.
Andere Staaten sind Konkurs…
Verglichen mit anderen Staaten steht die Schweiz hervorragend da. Italien wird seine Staatsverschuldung auf gegen 160% hieven, Griechenland wird es vielleicht sogar schaffen, die 200er-Marke zu knacken. Spanien ist noch am Rechnen, da sieht es nach dem missglückten Lockdown in militanter Franco-Manier besonders düster aus. Frankreich und die USA lassen ihre aufgestauten Defizite auf deutlich über 100% hochschnellen, Deutschland von mustergültigen 60% wohl auf gegen 75%.
Einzelne EU-Staaten (wie Italien, Spanien und Griechenland) sind de facto bankrott – sie können sich nur noch mit EU-Hilfe refinanzieren. Doch Staatsbankrotte werden uns nächstens so oder so noch begleiten: Argentinien, Libanon, Ecuador, usw sind vermutlich nur die Vorboten… Länder wie Indien, Südafrika oder die Türkei sind auch auf dem Radar, sie werden sich wohl demnächst in die Arme des IMF schmeissen müssen.
Da erscheint unser Loch in der Bundeskasse geradezu als Gentleman-Delikt.
Wie saniert man einen Staat?
Die Frage ist natürlich eine rhetorische: Man saniert entweder mittels Einsparungen und/oder mittels mehr Steuereinnahmen. Kurzfristig wählen die meisten Staaten allerdings eher einen einfacheren, einen dritten Weg nämlich: Man saniert mit Vorliebe mittels erhöhter Schuldenaufnahme. Geld kostet ja nichts, und Schulden müssen vielleicht nie zurückbezahlt werden – so die Denke vieler Politiker und Regierungen heute.
Ein Staat sollte zur Sanierung natürlich auch die Wirtschaft ankurbeln. Das wäre längerfristig die eleganteste und intelligenteste Sanierungsmethode. Nur wird der Vorgang leider oft falsch verstanden. Anstatt sich von vielen administrativen und anderen Fesseln zu entledigen, die vor allem die Unternehmen beuteln, lanciert man z.B. in Deutschland in alter Keynesianischer Manier teure Konjunkturprogramme. Oder man versucht mit ebenso falsch verstandenen konjunkturpolitischen Methoden den Konsum anzukurbeln, indem beispielsweise die deutsche MwSt. während 6 Monaten um 2 bzw. 3% gesenkt wird. Natürlich hoffnungslos. True Economics hatte schon früher vorgerechnet: Der Becher Joghurt vergünstigt sich so (sofern die Steuer-Reduktion auch an die Konsumenten weitergegeben wird) um genau einen Cent. Natürlich ist dadurch zu befürchten, dass gleich alles leerverkauft wird…
Mittelfristig steigt der Steuerdruck
Mittelfristig wird der Steuerdruck mit Sicherheit wieder steigen. Die heutigen Hochrechnungen der Staaten schliessen nämlich den Umstand oft aus, dass das Steuersubstrat in den nächsten Jahren weiter schmelzen wird.
Wie in vielen anderen Ländern auch, können die Verlustvorträge der Firmen – in der Schweiz während den kommenden sieben Jahren – mit Gewinnen kompensiert werden. Ergo ist damit zu rechnen, dass auch in kommenden Jahren das Steuersubstrat reduziert wird. Denn die Höhe der Unternehmensverluste im 2020 und vermutlich auch 2021 sind noch nicht abzuschätzen, werden jedoch erheblich sein und noch während Jahren fiskalisch nachwirken.
Da der Staat es also nicht schafft zu sparen oder die Wirtschaft gescheit anzukurbeln, werden kurzfristig weiter Schulden aufgenommen. Geld wird vermutlich sogar verstärkt von den Zentralbanken mehr oder weniger direkt in den Staatshaushalt umgeleitet werden – ein gefährlicher Frevel. Das Fed und die EU machen es vor. Doch irgendwann wird Schluss sein mit lustig, hohe Inflationsraten könnten drohen.
Die MMT (Modern Monetary Theory) meint zwar, dass ein Staat gar nie richtig Konkurs gehen kann und dieser fast unbeschränkt Schulden aufnehmen und/oder Geld drucken kann. Diese Theorie ist Gift. Die Geschichte zeigt uns, wohin das führen kann. Und es gibt keinen Grund, dass die Geschichte jetzt plötzlich ausgehebelt wird und rund um den Globus 195 monetäre staatliche Perpetuum mobile entstehen könnten.
Steuern in der Krise zu erhöhen, ist kontraproduktiv. Dass der Staat neue Einkommen braucht, ist andererseits keine neue Erkenntnis, der Forderungen dafür gibt es deshalb viele. Somit ist es klar: Irgendwann brechen die Regierungen jeweils ein und die Steuern werden erhöht – auch im dümmsten Moment. Doch ist das die Lösung?
Die intelligente Sanierung scheitert – also doch Steuern?
Wir sind uns also einig: Die Staaten werden es kaum schaffen, ihre Einnahmen effizienter einzusetzen, Schulden können nicht ewig aufgenommen werden, und Einsparungen kriegen sie auch nicht richtig hin. Insbesondere in südlichen Ländern können die Steuern gar nicht umfassend eingetrieben werden, es blüht zudem die Schattenwirtschaft. Wo soll also angesetzt werden, um notfalls trotzdem neue Steuern einzutreiben zu können?
Wir werden darauf verzichten, nun die zum Teil haarsträubenden Steuerprobleme aller Staaten zu beleuchten. Konzentrieren wir uns im Folgenden auf die Schweiz.
- Einkommensteuern erhöhen?
Die effektive Steuerlast in der Schweiz ist im Vergleich zu vielen andern Staaten einigermassen moderat. Aber die Spitzensteuersätze in einzelnen Kantonen haben bereits Höhen erreicht, welche sich kontraproduktiv auswirken: Sie führen zu Abwanderungen. Und zwar nicht einfach in günstigere Kantone, sondern auch ins Ausland. An der Steuerschraube zu drehen, ist also gefährlich. Wenn aufgrund höherer Steuerlast keine direkte Abwanderung der Steuerzahler erfolgt, so wird zumindest die Einkommens-Abwanderung vermehrt mittels raffinierter Steuerkonstrukte erfolgen. Money talks, money walks.
Ein schönes Vorbild dafür ist Deutschland, die maximale Progression greift bereits ab 56‘000 Euro Jahreseinkommen. Kein Wunder, überlegen sich viele, gar nicht mehr zu verdienen und ziehen es vor, in der sozialen Hängematte zu liegen. Oder sie kommen ganz gerne zu uns in die Schweiz. Da lohnt sich das Geldverdienen noch einigermassen.
Unsere SP spielt mit dem Feuer, wenn sie mit der Idee kokettiert, eine „Reichensteuer“ für Einkommen ab CHF 300‘000 pro Jahr einzuführen. Leute mit solchen hohen Einkommen sind in der Regel in der Lage auszuweichen. François Hollande wollte 2013 eine Reichensteuer von 75% auf Einkommen von über einer Million Euro durchboxen. Die Steuer wurde nie eingeführt, vorsorglich hatten sich aber bereits hunderte von Topverdienern ins Ausland abgesetzt.
Also Hände weg vom Drehen an der Steuerschraube. Umverteilung im grossen Stil funktioniert nicht. Sie treibt Gutverdiener in die Flucht und fördert nur die Demotivation, mehr zu arbeiten, mehr Risiken einzugehen – und damit mehr zu verdienen.
2. Vermögenssteuer erhöhen?
Die SP möchte auch eine Vermögensabgabe auf ganz hohen Vermögen einführen. Die serbelnde Partei mit den altsozialistisch verbrämten Umverteilungsideen vergisst jedoch, dass es in ganz Europa – ja weltweit – kaum Vermögensteuern gibt. In Europa werden nur noch in Norwegen Vermögenssteuern erhoben, in Frankreich und Spanien gibt es Vermögenssteuern auf Immobilien. Sonst sind Vermögensteuern weltweit fast tabu, auch in den USA gibt es keine. Nicht einmal in Deutschland!
Vermögenssteuern verhindern die Ansiedelung von Gutbetuchten und vertreiben reiche Schweizer – z.B. Besitzer von grossen Unternehmensteilen, für deren Werte, je nach Kanton, Vermögenssteuern erhoben werden, welche bisweilen sogar zu Zwangsverkäufen von solchen Unternehmensteilen führen können.
Vermögensteuern wirken oft kontraproduktiv. Eine Erhöhung würde das Gesamt-Steuersubstrat letztlich reduzieren. Eine paar teure Kantone bekommen dies schon seit Jahren zu spüren.
3. Einmalige Vermögensabgabe?
In der Folge der Finanzkrise hatte Christine Lagarde als IMF-Chefin die impertinente Idee lanciert, eine einmalige Vermögensabgabe von 10% auf allen Individualvermögen zugunsten der Staatshaushalte einzufordern. Wetten, dass die Juristin (sie ist keine Ökonomin) als heutige EZB-Chefin dieses Thema demnächst nochmals aufgreifen wird?
Thomas Piketty (nochmals ein etatistischer Franzose) wird als Starökonom zurzeit etwas gar gefeiert. Er mag in einigen Dingen recht haben: Es ist in der Tat stossend, dass die 1% Reichsten der Bevölkerung rund 50% besitzen. Die Schere ging in den letzten Jahren insbesondere in den USA weiter auseinander. Piketty fordert jedoch einen unrealistischen und radikalen Ausgleich von Vermögenswerten.
In der Schweiz hat sich die Vermögens-Schere nicht weiter aufgetan. Hoffen wir, dass dieser Kelch einer Vermögensabgabe an uns vorübergehen wird. Zumal die wahren Probleme der Staaten mit einer solchen Umverteilung gar nicht zu lösen wären – die propagierte „Wiedergutmachung zwecks Chancengleichheit“ bleibt ein abenteuerlicher Traum.
4. Kapitalertragssteuern erhöhen?
Kapitalerträge werden in der Schweiz bereits sehr hoch besteuert, sie unterliegen der normalen Steuerprogression – welche je nach Kanton bis zu 40% gehen kann. Selbst in Deutschland werden Kapitalerträge (etwa Dividenden) pauschal nur mit 25% besteuert.
Keine gute Idee also, hier anzusetzen.
5. Kapitalgewinnsteuern einführen?
Die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer wird von linker Seite immer wieder gefordert. Die meisten europäischen Staaten kennen sie. Dabei bleiben oft gleich zwei Punkte vergessen: Erstens ist die Erhebung und Administrierung einer solchen Steuer sehr aufwendig, zweitens haben wir in der Schweiz die Kapitalgewinnsteuer quasi mit unserer Vermögenssteuer substituiert. Zweimal auf Kapitalien abliefern geht nicht.
Also auch keine realistische Idee.
6. „Reichensteuer“ einführen?
Das Thema haben wir bereits unter Punkt 1 abgehandelt. „Reichensteuern“, „Reichtumssteuern“, „Milliardärssteuern“ – der Wunschbegriffe gibt es viele. Hoffentlich bleiben es Wünsche, denn deren Auswirkungen sind nur kontraproduktiv.
7. Erbschaftssteuern einführen und/oder erhöhen?
Die SP – schon wieder – forderte im Zuge der Pandemie-Finanzierung eine Steuer auf hohen Erbschaften. Vor Jahren hatte das Stimmvolk ein solches Begehren bereits abgelehnt. Schon damals jedoch wirkte nur schon die Abstimmungsinitiative als Brandbeschleuniger: Zahlreiche Vermögensteile wurden noch vor der Abstimmung verschoben.
Die Erbschaftssteuern sind kantonal sehr unterschiedlich und bewirken sogar Wohnortwechsel. Selbstredend auch global, nicht nur von einem Kanton in den andern.
Zu hohe Erbschaftssteuern führen nicht nur zur Abwanderung oder verhindern Zuzüge, sie fördern auch die Errichtung von Umgehungskonstrukten. (Kein Wunder, steckt ein Grossteil der Vermögen von britischen Bürgern in Trusts auf illustren Inseln, denn die Erbschaftssteuer von 40% für direkte Nachkommen ist in der Tat absurd.)
Auch Deutschland hat ein Problem mit seinen 19% Erbschaftssteuern für Ehepartner oder direkte Nachkommen. Auch wenn unter gewissen Auflagen Steuerreduktionen gewährt werden, können KMUs zum Teil nicht überleben, weil bei deren Übergabe die Nachkommen die hohen Steuern schlicht nicht aufbringen können.
In der Schweiz weist das Erbschaftsrecht ebenso Defizite auf und müsste dringend modernisiert werden: Zum Teil absurd hohe Steuern bis zu 50% für nicht-verwandte Begünstigte (z.B. auch für Lebenspartner) oder unnötig hohe Pflichtteile entsprechen nicht mehr dem Zeitgeist.
Andererseits wäre es verträglich, eine minimale Erbschaftssteuer im einstelligen Bereich auch für direkte Nachkommen zu erheben. Eine solche Steuer würde den Staaten-Wettbewerb kaum verzerren und auch nicht zu Abwanderung führen. In den nächsten Jahren werden enorm hohe Milliardenbeträge der Babyboomer-Generation weitergegeben. Eine moderate Abgabe auf Bundesebene für direkte Nachkommen wäre in der Tat verträglich. True Economics – ansonsten eher der Steuerphobie verschrieben – könnte hier sogar einwilligen!
8. Sozialabgaben erhöhen?
Sozialversicherungen wie die Arbeitslosenkasse oder die AHV sind klamm. Die erste ist pandemiebedingt bald illiquid, die zweite aus demografischen und systemischen Gründen langfristig nicht mehr zahlungsfähig. Also bräuchte es mehr Abgaben oder Steuern? Eine Erhöhung der Sozialabgaben verringert allerdings die Wettbewerbsfähigkeit und schmerzt Arbeitnehmer wie Arbeitgeber sehr direkt. Deshalb ist es zu bevorzugen, einerseits Systemanpassungen vorzunehmen, andererseits die Alimentierung dieser Sozialkassen eher aus dem Bundeshaushalt sicherzustellen. Die entsprechenden Steuereinnahmen dazu könnten – so diese tatsächlich zusätzlich notwendig werden, weil die Systemanpassung aus politischen Gründen nur mühsam greift – ziemlich elegant mittels Mehrwertsteuer finanziert werden (siehe Punkt 17, Mehrwertsteuer).
9. Immobiliensteuern erhöhen und/oder einführen?
Die SP denkt auch immer wieder darüber nach, neue Steuern auf Immobilien einzuführen – so z.B. für kommerzielle Immobilienanbieter. Ein solches Begehren gilt es klar abzuwenden, es führt auch hier zur Wettbewerbsbehinderungen und zu Kapitalverlagerungen. Es reicht schon, dass wir in der Schweiz unter dieser unsäglichen Eigenmietwertbesteuerung leiden – eine helvetische Sondersteuer notabene, die es fast nirgends gibt, nicht einmal in der germanischen Steuerhölle.
10. Firmensteuern erhöhen?
Der internationale Druck steigt, damit gewisse Mindeststeuern für Firmen eingeführt werden. Wir haben es in der Schweiz geschafft, diesem Druck etwas nachzugeben, indem wir dank klugen Reformen trotzdem ein attraktiver Steuerort geblieben sind. Kantone, die heute zu hohe Firmensteuersätze kennen, werden mittelfristig leider an Steuersubstrat verlieren. Sie werden es bereuen.
Die SP – schon wieder – hat bereits laut über einen Pandemie-Zuschlag von 5% auf den Unternehmenssteuern nachgedacht. Ein sehr kurzsichtiger Plan natürlich. Die Firmensteuern dürfen wir auf keinen Fall erhöhen. Firmen haben kein soziales Umfeld, sie wandern deshalb noch schneller ab als Individuen.
11. „Pandemiesteuer“ einführen?
Eine besonders verquere Idee kam kürzlich auf: Die „Gewinner der Pandemie“ sollten besteuert werden. Also Online-Anbieter und andere „digitale Profiteure“, auch Pharmafirmen, etc. – Firmen also, welche in der Krise Ausserordentliches geleistet haben.
Einsatz, Risikobereitschaft (und generell: unternehmerisches Denken) müssen auch in Zukunft weiterhin belohnt werden.
Abstruse Ideen wie „Pandemiesteuern“ müssen blitzartig beerdigt werden.
12. Energiesteuern erhöhen?
„Energiesteuern“ kennen wir schon heute. Sie sind zum Teil auch sinnvoll, sofern sie den Energieverbrauch tatsächlich nachhaltig reduzieren – und nicht nur staatliche Abschöpfung darstellen. Wichtig ist, dass solche Abgaben einfach und transparent erhoben werden, sodass damit auch edukative Effekte erzielt werden. „Energiezertifikate“ zum Beispiel begreift niemand, eine CO2-Abgabe schon eher. Die Abgabe auf einem Liter Heizöl oder Benzin oder auf einer Kilowattstunde Strom lässt sich erklären. Solche Steuern müssen jedoch international wettbewerbsfähig bleiben, Alleingänge können Schäden anrichten.
Tatsächlich könnte zum Beispiel überlegt werden, ob bei stark sinkenden Erdölpreisen nicht eine Teil-Abschöpfung durch den Staat erfolgen könnte. Es müsste dafür jedoch ein intelligentes Modell entwickelt werden, welches sich einfach umsetzen lässt und nicht sofort zu individuellen Ausweichmanövern führt.
13. Finanztransaktionssteuer einführen?
Eine solche Steuer hat sich als kaum umsetzbar erwiesen, auch nicht die Variante mit der „Mikrosteuer“: Die Administrierung solcher Abgaben ist zu aufwendig. Ausserdem können diese nur international erhoben werden, andernfalls sind sofortige Wettbewerbsnachteile in Kauf zu nehmen.
Hier lässt sich also nichts holen.
14. Online-Steuern einführen?
Online-Steuern sind schwierig zu erheben, die meisten Anbieter verfolgen heute den Ansatz der Omni-Channels – also den Verkauf sowohl online als auch über stationäre Kanäle, wobei der Warenbezug zum Teil in gemischter Form erfolgen kann. Den Online-Umsatz spezifisch besteuern zu können, ist damit eine Illusion.
Tatsache ist indessen, dass internationale Online-Anbieter kaum Steuern bezahlen – ein durchaus stossender Umstand. Mit zunehmendem Online-Anteil wird sich das Problem noch verschärfen, damit allerdings auch der internationale Wille, hier anzusetzen.
National lässt sich eine Online-Steuer nicht einführen. Frankreich kämpft gerade mit US-Retorsionsmassnahmen, weil La Grande Nation sich diesbezüglich in ein Minenfeld begeben hat.
Aus diesen Online-Töpfen wird man sich demnächst also nicht bedienen können.
15. Stempelabgaben und ähnliche Steuern erhöhen?
Solche Steuern sind nur im Rahmen eines Schutzes der guten internationalen Wettbewerbsfähigkeit sinnvoll. Also bräuchten wir in der Schweiz eher einen Abbau solcher Abgaben.
16. Negativverzinsung erhöhen?
Die Negativverzinsung ist eigentlich eine Art Steuer, und zwar eine ziemlich gemeine: Sie führt zu einer schleichenden Erosion des individuellen Vermögens, während der Staat – bzw. die Nationalbank – kassiert. In ihrer Wirkung also tatsächlich eine Fiskalabgabe. Allerdings keine sehr gute, sie führt zu Abwanderung von Vermögen, zu Immobilien- und anderen Spekulationsblasen und aufgrund der zinsbedingt erodierenden Renditen zu ungesicherten Renten. Junge Leute können mittels Sparen zudem kaum mehr Kapital anhäufen. Negativzinsen sind in ihrer Wirkung sehr unsozial, denn nur die grossen Kapitalbesitzer können mit klugen Investitionen ausweichen.
Wenn die eingesackten Negativzinsen der Nationalbank dann in den Staatshaushalt gekippt werden, ist der Fiskalvorgang abgeschlossen. Keine schöne Sache generell – und keine gute Idee, auf diesem Weg noch mehr einnehmen zu wollen.
17. Mehrwertsteuer erhöhen?
Die Mehrwertsteuer hat den Vorteil, dass sie ziemlich flächendeckend erhoben werden kann. Klamme Länder erhöhen diese Steuer in der Regel als erstes.
Aber Vorsicht: Steigt die MWST z.B. über 12%, wirkt sie plötzlich als Katalysator für die Schattenwirtschaft. Nicht umsonst ist diese sogar in Deutschland etwa doppelt so hoch wie in der Schweiz (schliesslich ist die MWST dort auch doppelt so hoch). Länder wie Spanien (21%), Italien (22%) oder Griechenland (24%) haben diese Steuer bereits mehr als ausgereizt. Kein Wunder, grassiert hier die Schattenwirtschaft besonders stark. Bevor Griechenland dem Binnenmarkt beitrat, betrug die Steuer sogar 36% – wenig erstaunlich, dass sie selten abgeliefert wurde.
Insbesondere südliche Länder werden des öfteren von MWST-Betrügereien gebeutelt. Je höher die Steuer, desto höher liegt die Versuchung, doch lieber ein schnelles Bargeschäft ohne Rechnung und Quittung zu tätigen. Deshalb ist die aktuelle Idee von einigen verträumten spanischen Politikern, die MWST auf 30% zu erhöhen, wohl nicht sehr zielführend. Saudi Arabien verdreifachte jüngst die MWST über Nacht auf 15% – zu viel auf einmal natürlich, denn jetzt wird auf Teufel komm raus betrogen.
In der Tat könnte die Schweizer MWST durchaus erhöht werden. Gewisse Kreise betrachten dies allerdings als einen sehr unsozialen Plan. Rund 50% der Schweizer Steuerzahler liefern keine Bundessteuer ab, weil ihre Einkommen zu tief sind. Also sollte man diese Gruppe wohl auch weiter schonen – so die generelle Denke der Gegner von Mehrwertsteuern und deren Erhöhungen. An sich ein hehrer Gedanke. Nur: Eine moderate Erhöhung der MWST wäre kaum spürbar.
Der starke Franken und die einhergehende Deflation aufgrund günstigerer Importe führen mittelfristig wohl zu weiter sinkenden Preisen. Umso mehr wäre eine Erhöhung der MWST verträglich. Viele Produkte sind in der Schweiz massiv teurer als im Ausland. Beispiel Nivea, Pampers oder Waschmittel: Oft bezahlen wir das Doppelte oder Dreifache für gewisse Artikel. Die Abschöpfung findet dabei bereits beim Produzenten im Ausland statt. Eine MWST-Erhöhung würde also zum Teil wohl gar nicht weiterverrechnet, sie käme beim Konsumenten gar nicht an. Die Produzenten würden vermutlich auf einen kleinen Teil ihrer eh zu üppigen Margen verzichten.
Eine MWST-Erhöhung wäre nicht wettbewerbsverzerrend, mit dem rekordtiefen Schweizer Satz von heute 7.7% hätten wir noch viel Ausbaupotential. Wettbewerbsverzerrend sind eher die generell hohen Schweizer Preise. Wenn schon, müsste hier angesetzt werden!
In der Tat: Falls überhaupt Steuererhöhung, so könnte eine solche ziemlich schmerzfrei via Erhöhung des MWST-Satzes stattfinden. Könnte.
Steuererhöhungen? Wenig Ausbeute, aber ein bisschen schon.
Gouverner, c’est prévoir. Die wahren Staatsaufgaben sollten darin bestehen, den Staatsapparat effizient zu führen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und die Wirtschaftsaktivitäten zu fördern. (Abgesehen von den vielen andern Aufgaben aus den Bereichen Sicherheit oder Wohlfahrt zum Beispiel.)
Tatsächlich verbleiben nur wenige intelligente Steuerlösungen, so denn die Steuern doch erhöht werden müssten: Bei der MWST könnte man sich alimentieren, bei den Energiesteuern, allenfalls bei den Erbschaftssteuern.
Fazit:
Die Steuern müssen gar nicht erhöht werden. Und wenn, dann – notfalls! – höchstens in Teilbereichen wie bei der MWST, allenfalls bei Energie- oder den Erbschaftsteuern.
Die pandemiebedingten Budgetdefizite dürfen wir in der Schweiz vorerst getrost in der Bilanz stehen lassen, die Refinanzierung bleibt wohl auch längerfristig zinslos.
Ersparnisse im öffentlichen Haushalt sollten mittels mehr Effizienz beim staatlichen Konsum erreicht werden, nicht jedoch bei den staatlichen Investitionen (in die Infrastruktur z.B.). Steuererhöhungen jedoch – insbesondere in einer Wirtschaftskrise – sind alles andere als zielführend.