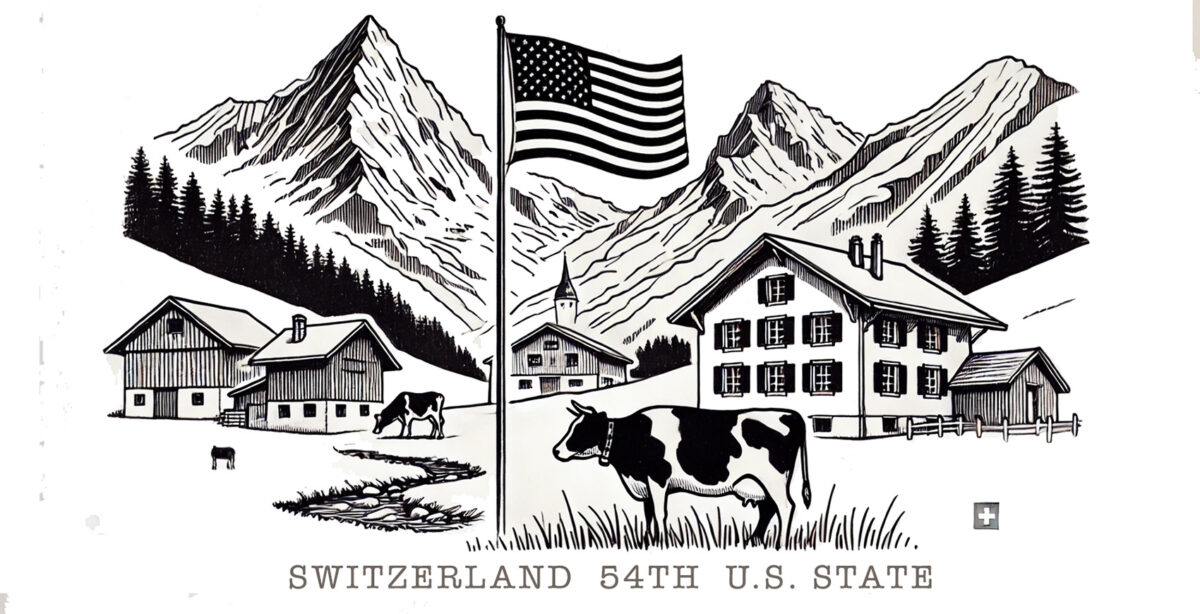Waldmeyer hatte sich schon daran gewöhnt, dass Präsident Trump provokative Äusserungen zum Besten gibt. Seine Ideen sind manchmal auch ganz lustig – oder zumindest kreativ. Aber oft auch ziemlich ernst gemeint. Und diese Ideen könnten erst der Anfang sein. Waldmeyer schaut voraus.
Waldmeyer erinnert sich: Während Trumps erster Regentschaft ärgerte sich dieser über die teuren Unterstützungsgelder, welche Puerto Rico verschlang. Puerto Rico ist, wie wir wissen, de facto eine Kolonie der USA. Der Begriff «Kolonie» wird heute selbstredend nicht mehr verwendet, aber er definiert den Status der Insel, leicht östlich von Haiti und der Dominikanischen Republik gelegen, treffend. Das Eiland von ungefähr doppelter Grösse Graubündens und mit der Einwohnerzahl Berlins etwa wurde 2017 vom Hurrikan Maria heimgesucht und war anschliessend ziemlich versehrt und technisch bankrott. Schon früher stand es jedoch mit den Finanzen um den mit den USA halbwegs verbundenen Kleinstaat nicht zum Besten. Puerto Rico ist ein «non-incorporated territory» – und damit eben kein Bundesstaat, nur eine karibische, mehr oder weniger kaputte Aussenstation. Kein Wunder, fragte Trump 2017 deshalb seine Mitarbeiter, ob man dieses defizitäre und beschädigte Asset nicht «verkaufen» könnte. Schon 2012 hatten sich die Puerto-Ricaner bei einer Abstimmung für die Aufnahme eines vollwertigen 51. Bundesstaates ausgesprochen – was Donald Trump indessen überhaupt nicht kratzte. Donald «The Chosen One» betrachtet Länder nämlich so, wie er früher eine Immobilie oder Bauland betrachtet hatte, also als ein Aktivposten in der Bilanz eines Konglomerates.
Deshalb war Trumps Anschlussfrage, damals, auch stimmig, ob man denn nicht Grönland kaufen könnte. Und jetzt wieder. Diesmal mit der Nachricht, Grönland müsse zur USA kommen, weil dies im nationalen Interesse sei. Es geht vor allem um Handelsrouten und die Rohstoffe, da liesse sich doch etwas mehr machen aus dieser vernachlässigten Insel, ist Trump überzeugt. Dass nun auch Panama auf der Shoppingliste steht (oder zumindest das Gebiet rund um den Panama-Kanal) ist deshalb nur schlüssig. Schliesslich gilt es, diese wichtigen Handelswege besser abzusichern. Auch die Einladung an Kanada, der 51. Staat der USA zu werden, ist somit konsequent.
Das alles mag, zumindest vordergründig, ganz amüsant sein. Aber Waldmeyer findet das auch äusserst bedenklich, vor allem, dass Trump auch “militärische Aktionen nicht ausschliessen“ würde, um seine Ziele zu erreichen. In diesem Sinne, und nun die erschreckende Erkenntnis, nähert sich die Politsprache der USA derer Chinas an, welche Taiwan «zurückmöchte». Auch der Hintergrund und die Begründungen für alle diese Vorhaben weisen ähnliche Muster auf, weil Fakten verdreht oder legitime Ansprüche suggeriert werden. Pro memoria: Taiwan hatte vor dem Zweiten Weltkrieg gar nicht zu China gehört, sondern war Teil (oder eben auch eine «Kolonie») Japans. Aber das spielt keine Rolle. Wir müssen nun von den neuen Leadern der Welt lernen, dass Ansprüche immer berechtigter werden, je länger man sie äussert.
Auch Russlands Anspruch auf die Ukraine gründet faktisch auf keiner Legitimität. Trotzdem findet dieser Hegemonismus grossen Zuspruch, weltweit. Auch ein immer breiterer Teil der Bevölkerung und viele politische Parteien in Europa finden das durchaus in Ordnung.
Es kristallisiert sich also eine neue Politsprache raus. Hemmungen werden abgebaut, man darf fordern – und die Durchsetzung der Forderung scheint dann immer mehr zum Courant normal zu werden. Auch wenn der venezolanische Präsident eine Einverleibung seines Nachbarstaates Guyana fordert, lächelt die Welt nur etwas und nimmt es einfach zur Kenntnis.
Imperialismus ist also wieder salonfähig.
Es scheint, als ob man nun neu ziemlich offensichtlich in die Politik anderer Staaten eingreifen darf: Russland kauft Wählerstimmen in Georgien und Moldawien, das gleiche Land greift auch direkt in die Präsidentschaftswahlen Rumäniens ein. Elon Musk, globaler Adlat Trumps, nimmt offen Partei für die AfD in Deutschland, bewundert Orban, ermuntert die FPÖ oder möchte Grossbritannien von der Tyrannei seiner Regierung «befreien».
Ob wir da wohl vor einer Zäsur in der Geopolitik stehen? Waldmeyer stand vor seinem Kamin in Meisterschwanden, das Feuer loderte lustig, er schlürfte an einem Cognac und platzierte seine kosmopolitischen Überlegungen. Charlotte schaute immer tiefer in ihr dickes Buch rein («Slow Cooking in Peru»). Waldmeyer holte etwas aus und stellte sich vor, was die nächsten globalen Schritte sein könnten. Erstens wird die Regierung Trump von ihren Forderungen nicht abrücken (so beispielsweise in Sachen Grönland). Zweitens wird sich China ermuntert fühlen, Taiwan zu annektieren. Drittens wird Russland seine Fühler weiter ausstrecken (so z.B. nach Spitzbergen, mithin eine Kolonie Norwegens, aber von grossem Interesse für Russland). Und dann kommt der vierte Schritt: Trump wird vorschlagen, dass die Schweiz der 54. US-Staat werden soll.
„Wo würdest du lieber wohnen, Charlotte: in einer neuen umgebauten Schweiz nach Plänen der Jungen Grünen und der Jusos oder im 54. US-Staat?“ Charlotte antwortete nicht und Waldmeyer fuhr mit seinen Ausführungen fort: Der Anschluss der Schweiz an die USA entbehrt tatsächlich nicht einer gewissen Logik. Das für die Grösse der Schweiz gigantische Handelsbilanzdefizit der USA mit dem kleinen Land könnte so elegant getilgt werden, denn die Handelsströme wären dann nur noch US-interne Bewegungen. Die Schweiz gehört nicht zur EU, ja, sie hat nicht einmal einen gescheiten Vertrag mit diesem Club. Der Schweizer Franken stellt ein Risiko dar, denn in Krisenzeiten explodiert diese Währung jeweils, und das Land gelangt mit ihren Exporten in die Bredouille. Die Übernahme des USD würde also Sinn machen – eine globale Währung zu haben wäre wesentlich gescheiter als sich dem lahmen Euro zuzuwenden oder den viel zu volatilen CHF zu behalten. Die UBS wird ihren Hauptsitz eh nach New York verlegen. Da sie dann keine Konkurrenz mehr zu den amerikanischen Banken darstellt, kann sie ungestörter ihren Geschäften nachgehen. Und die wichtigen Aussenstationen der amerikanischen Techfirmen (wie Zürich für Google) gehörten dann direkt zur USA.
Es mag auch ein paar wenige Nachteile für die Schweiz geben. So müsste die Eidgenossenschaft die Stationierung von ein paar Langstrecken-Raketen im Jura dulden. Vielleicht würden sich auch unsere gastronomischen Gepflogenheiten leicht ändern. Andererseits würden vermutlich die Strassen in den Städten wieder renaturiert – also wieder natürliche Strassen werden, mit vier und nicht zwei Spuren, und diese wären wieder mit einem normalen Tempo befahrbar. Absurden Weltverbesserungs-Initiativen aus der grünen und linken Ecke würde der Stecker gezogen. Und so weiter. Die ungebührliche Immigration aus uns fremden Ländern würde vermutlich eingedämmt, und ein paar nette Ami-Familien würden in unsere Städte ziehen – in denen plötzlich wieder gebaut werden darf.
Alles also gar nicht so schlimm? Wenn Waldmeyer die momentane Zäsur in der Geopolitik betrachtet und die kleine Schweiz sich in Reduit-Gedanken suhlt und sich so ins Abseits manövriert, wäre doch ein Befreiungsschlag eine elegante Lösung. Besonders angesichts der aktuellen politischen Entwicklung Helvetiens und des von vielen Kreisen beabsichtigten «Umbaus der Gesellschaft» könnte der Anschluss der Schweiz an die USA tatsächlich eine valable Option darstellen, meint Max Waldmeyer.
«Warum eigentlich genau der 54. Staat…?», fragte Charlotte ihren Max und unterbrach seine nach wie vor stehend vorgebrachte Vision vor dem Kamin, immer noch mit einem Glas Cognac in der Hand. «Und du müsstest dann Bourbon trinken, den Cognac kannst du gleich vergessen.»
Waldmeyer antwortete verzögerungsfrei: «Der 51. Staat wird Kanada sein, Nummer 52 Panama. Beim Verkauf von Puerto Rico wird keine Nummer frei, weil es ja nie ein US-Staat war. Somit wird die 53 für Grönland reserviert sein. Folglich, der Logik entsprechend: Switzerland will be the 54nd U.S. state. Und: Die Amis kennen ein paar ausgezeichnete Bourbons, da mache ich mir keine Sorgen.»