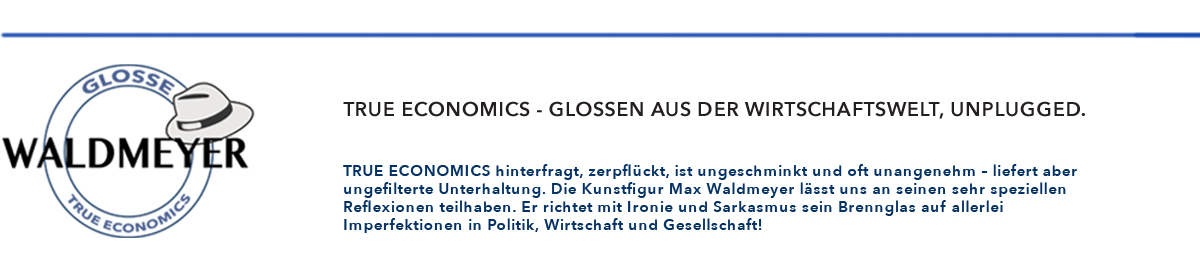Max Waldmeyer hatte beschlossen, seinen Sommerurlaub bei schönstem Wetter am See zu verbringen, in sicherer Umgebung, mit hervorragender Gastronomie und mit Zugriff auf einen gut bestückten Weinkeller: nämlich zu Hause, in Meisterschwanden. Gleichzeitig konnte er sich so bestens philosophischen Tagträumen hingeben.
Waldmeyer blickte von seiner Terrasse zum Hallwilersee runter und überlegte, dass Schiffe in der Regel nur Unglück bringen.
«Abramovichs Yacht würde hier nicht reinpassen», meldete Waldmeyer zu Charlotte rüber, die anstatt in der brütenden Hitze jetzt lieber in Grönland sitzen wollte. Sie antwortete nicht.
«Wenn du viel Geld hättest, Charlotte, ich meine wirklich sehr, sehr viel Geld, was würdest du dir kaufen…?» Bei diesen grundsätzlichen, fast philosophischen Fragen pflegte Charlotte in der Regel zu antworten, deshalb legte Waldmeyer nun so auch seine Fragefallen aus.
«Ich würde einen Fonds errichten und etwas Gescheites damit anfangen. Vielleicht etwas Soziales».
«Wenn du aber keinen Fonds errichten könntest und du gezwungen wärst, das Geld auszugeben, ich meine, im grossen Stil, was würdest du dir kaufen?», bohrte Waldmeyer nun weiter.
«Zeit. Vielleicht auch Zeit ohne dich», antwortete Charlotte. Waldmeyer kannte diese provokativen Antworten und liess sich nicht beirren.
«Was würdest du zum Beispiel mit einer fetten Rolex machen?»
«Ich würde Sie sofort verkaufen.»
«Was mit einem Lamborghini?»
«Hätte ich gar nie gekauft.»
«Ich kauf dir ein Schloss!»
«Brauch ich nicht.»
«Einen Privatjet?»
«Würde ich sofort grounden».
«Eine Yacht?»
«Bringt nur Unglück.»
Waldmeyer gab auf. Zumal Charlotte recht hatte. Yachten sind zwar das ultimative Aushängeschild von Luxus, es ist die perfekteste aller Visitenkarten der Arriviertheit. Der Yachtbesitz ist das ultimative Statement. Über Yachten spricht man. Pro forma versuchen Superreiche, die Besitzstruktur einer Yacht zu verschleiern, indessen nur in der Hoffnung, dass der Besitzer entdeckt und in den Medien breitgeschlagen wird.
Man weiss, dass Yachten ein Vermögen kosten, bei grösseren Yachten rechnet man um eine Million pro Meter Länge. Bei ganz grossen Schiffen darf es durchaus auch mehr sein. Privatjets und/oder Schlösser verblassen daneben in einer Aussenwirkung, die fast den Insignien des Mittelstandes entspricht.
Die Credit Suisse hatte sich auf die Finanzierung von Yachten spezialisiert, ein Milliardengeschäft. An sich ist es rätselhaft, wieso Milliardäre ihre Superyachten nicht selbst finanzieren wollen. Die grössten Schiffe sind über 150 Meter lang und kosten über 500 Millionen Dollar. Aber wenn man mehrere Milliarden besitzt, so sollte man doch meinen, könnte so ein Kahn doch aus der Portokasse bezahlt werden. Offenbar nutzen Milliardäre ihr Cash jedoch, um clever alternativ zu investieren und damit noch mehr Rendite zu erzielen; also «hypotheziert» man eben eine Yacht. Der Credit Suisse hatte dieses Spezialgeschäft indessen kein Glück eingebracht. Erstens zeigte sich, dass Oligarchen, Scheichs und auch ganz normale Despoten die Zinsen auf diesen Yachthypotheken nur unregelmässig entrichten. Dem Geld anschliessend in Saudi-Arabien oder in Russland nachzurennen, erwies sich indessen als ziemlich tricky. Zweitens implodierte der Markt für Superyachten aufgrund der Sanktionen gegen russische Oligarchen seit dem Beginn des Ukrainekrieges. Die Kredite für Yachten lagen plötzlich höher als ihr Wert. Und jetzt wirft man der Pleitebank auch noch vor, in Sachen Yachtfinanzierung Sanktionen umgangen zu haben. Nichts als Unglück also für die Credit Suisse. Wie die UBS nun damit wohl umgehen wird…?
Insbesondere die Superyachten der Russen bescheren wohl auch den Russen immer weniger Glück. Aufgrund der Sanktionen gibt es kaum mehr attraktive Häfen, wo man seine Yacht zeigen kann. In Dubai ist das Anlegen für die Oligarchen zwar noch möglich, allerdings mit reduzierter Aussenwirkung, denn dort liegen inzwischen so viele Yachten, dass die eigene meistens im Schatten der allergrössten liegt. Und à propos Schatten: Abramovich lässt seine Yachten (er besitzt tatsächlich mehrere dieser grossen) im Sommer natürlich nicht in Dubai anlegen – bei gegen 50 Grad Hitze. Er wählt Bodrum in der Türkei oder Montenegro. Aber dann ist Schluss mit der Hafen-Auswahl. Ausser er würde Anker werfen vor Novosibirsk (der eisfreie Hafen in Sibirien), was indessen jeglicher Attraktivität und Imagegewinnung entbehrt. Nichts als Sorgen also mit den Superyachten.
Sorgen bereiten auch die Unterhaltskosten. Yachten kosten, so die Faustregel, pro Jahr rund 10% des Kaufpreises. Für die Crew, Versicherungen, Hafengebühren, Treibstoff, Reparaturen, etc. etc.
Die intrinsischen Gewinne einer Yacht, also das Zurschaustellen von Reichtum und das Geniessen dieser Einzigartigkeit in den Schaufenstern der obersten Liga, haben sich heute also sozusagen sublimiert.
Waldmeyer freute sich, Yachten zu «konsumieren», indem er diese auf «MyShipTracking» studierte. Er stellte zwar fest, dass auf dem Hallwilersee keine von diesen Yachten auszumachen war. Aber weltweit eben schon. Diese geniale App kann alle Schiffe global tracken, sie meldet die Standorte, die Bewegungen, die Eckdaten jedes grösseren Kahns. Ja, so können Yachten – und sogar Superyachten – auch glücklich machen: Indem man sie nicht besitzt.
Mit Entsetzen entnahm nun Waldmeyer der Zeitung, dass die UBS entschieden hatte, das inkriminierte Yachtfinanzierungsgeschäft der Credit Suisse fortzuführen. Ob das der UBS wohl Glück bringen wird? Waldmeyer meldete zu Charlotte rüber: «Willst du nicht deine UBS-Aktien verkaufen? Die Yachten bringen kein Glück.». Charlotte antwortete nicht.