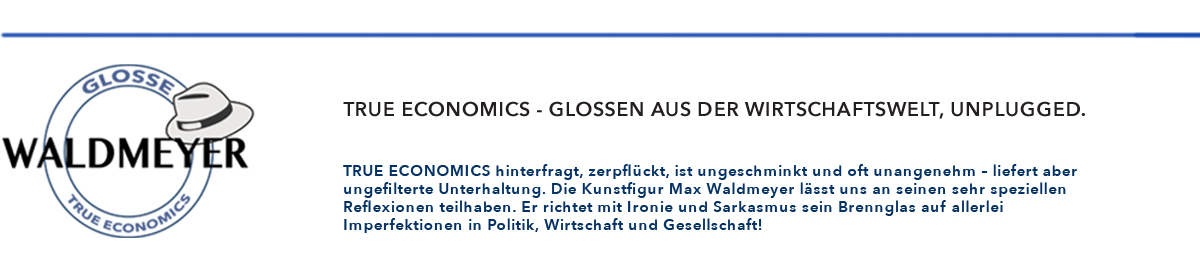Das grüne und linke Lager fordert mantramässig eine Reduktion der Arbeitszeiten. Um die Finanzierung dieser Spässchen sorgen sie sich nicht. Waldmeyer überlegte sich, wie er selber einen Beitrag zur Finanzierung leisten könnte.
Protagonisten der Jungen Grünen forderten kürzlich die 24-Stunden-Woche. Und die SP schwadroniert schon seit geraumer Zeit von der 35-Stunden-Woche. Auch die Unia, die stärkste und militanteste Gewerkschaft der Schweiz, nie um weltfremde und klassenkämpferische Forderungen verlegen, fordert mantramässig Ähnliches.
Was allen Forderungen gemeinsam ist: Die Arbeitszeitverkürzung soll bei gleichbleibendem Lohn erfolgen. Brave new world.
Je nach Tagesaktualität werden dazu die Argumente gereicht: Die Arbeit muss einerseits besser verteilt werden, damit alle auch Arbeit haben (angesichts des Personalmangels überall und der rekordtiefen Arbeitslosenrate wird dieser Ansatz zurzeit weniger berücksichtigt). Andererseits braucht es mehr Zeit „zum Leben“ – die Arbeitsbelastung ist einfach zu hoch. Auch ist die Erde zu klein, die Ressourcen sind begrenzt und wir müssen vom Konsum wegkommen. Natürlich geht es, wenn nach der Finanzierbarkeit der schönen Pläne geforscht wird, immer auch um Umverteilung: Von Kapital zu Arbeit. Ohne Klassenkampf ist da nichts zu machen.
In Frankreich beispielsweise wird ja sehr überzeugt und flächendeckend wenig gearbeitet, seit Jahren kennt man die 35-Stunden-Woche. Die Deutschen arbeiten 37.5 bis 40 Stunden pro Woche, bei den Italienern und Spaniern weiss man es nicht so genau. In der Schweiz sind es im Schnitt knapp 42 Stunden. Belgien versucht es derzeit mit einer 38-Stunden-Woche, verteilt auf vier Tage.
Soll unsere helvetische Überproduktivität nun reduziert werden? Insbesondere die Vertreter von völlig überarbeiteten Angestellten des Staates, der Kantone oder der Gemeinden sind offenbar dieser Meinung. Die SP in Baselstadt brachte jüngst eine Motion in den Grossen Rat, die gebeutelten Beamten nur noch 38, anstatt 42 Stunden arbeiten zu lassen. Unter anderem „wegen dem Fachkräftemangel“, weil man „konkurrenzfähig bleiben müsse“. Nun, vielleicht müssen die vier Stunden gar nicht durch neue, nicht zu findende Fachkräfte kompensiert werden – weil es diese gar nicht braucht.
Auch die Zürcher AL und die SP bleiben nicht untätig, denn mittels gleich zwei Vorstössen lancieren sie für städtische Angestellte einen Pilotversuch für die 35-Stunden-Woche. Flankiert wird der Test mit einer Viertageswoche.
Den Versuch mit der Viertageswoche hatte VW in Deutschland übrigens schon vor Jahren wieder abgebrochen. Plötzlich fehlte es an nämlich an Fachkräften, um die Produktion am Laufen zu halten.
Aber zurück in die Schweiz. Waldmeyer überlegte sich, wo denn die unterste Benchmark für die Arbeitszeit liegen könnte: vielleicht bei einer Zweitageswoche? Die Erosion der Arbeitsmotivation könnte so allerdings schon im Laufe des Dienstags stattfinden und die Erholungsphase dann bis Montagmorgen dauern.
Selbst wenn es gelänge, die Industrieproduktion mit so viel Raffinesse zu planen, dass fast nur noch Roboter an der Arbeit sind und die Gesellschaft vorab zu Hause hocken dürfte: Bei vielen politischen Weltverbesserern geht offenbar vergessen, dass wir heute eine Dienstleistungsgesellschaft sind. Waldmeyer beispielsweise möchte keinen Roboter als Zahnarzt. Es reicht ihm schon, wenn er im Baumarkt dazu gedrängt wird, seine Einkäufe selbst zu scannen.
In der Schweiz arbeiten 75% der Beschäftigten im Dienstleistungssektor. Und in vielen Bereichen findet Dienstleistung nun mal an sieben Tagen in der Woche statt: in der Hotellerie und der Restauration, im öffentlichen Dienst, bei vielen digitalen Supportleistungen, im Spital, etc., etc. Am Donnerstagabend kann also nicht Schluss gemacht werden. Da ist einiges an Koordination nötig, was sich mit einer Reduktion der Arbeitszeit schon logistisch nur mühsam regeln lässt.
Nun zurück zur Unia und der 35-Stunden-Woche. Mit immer wieder den gleichen Argumenten wird diese lanciert – so der Reduktion der hohen Belastung, der Verbesserung der Work-Life-Balance, der gerechteren Verteilung der Arbeit.
Was Waldmeyer allerdings nachdenklich stimmt: 80% der Schweizer arbeiten „eher gerne“, 20% „eher nicht gerne“. Ähnliche Untersuchungen in Deutschland oder Frankreich zeigen leider ein anderes Bild: 80% geben an, eigentlich nicht so gerne zu arbeiten.
Waldmeyer seufzte. Arbeitet man also lieber, wenn man mehr arbeitet? Oder arbeitet man mehr, weil man gerne arbeitet? Verfliegt die Lust an der Arbeit eventuell mit abnehmender Arbeitsbelastung? Seltsam. Zumindest eine Beobachtung hatte Waldmeyer schon gemacht: Unterbeschäftigte Beamte beispielsweise neigen dazu, plötzlich aufkommende Arbeit als zu viel zu betrachten.
Ein Lieblingsthema Waldmeyers sind die vielen „sozialen Hängematten“ in europäischen Ländern. Nebst der Rundumversorgung durch den Staat kommen hohe Absenzen dazu, viele Frei- und Urlaubstage, ausgedehnte Elternurlaube, etc. Spanierinnen erfreuen sich an regelmässigen freien Menstruationstagen und Italienerinnen im gebärfähigen Alter müssen, bei intelligenter Kinderplanung, eigentlich während Jahren gar nie arbeiten – sie profitieren aber trotzdem von Lohnfortzahlungen. Der Franzose andererseits lässt sich gerne schon mit Mitte 50 pensionieren.
Das kostet natürlich alles. Den Staat, die Gesellschaft, die Firmen. Frankreich, nun auch nur wieder beispielsweise, hat sich inzwischen quasi de-industrialisiert. La Grande Nation ist in vielen Bereichen nicht mehr wettbewerbsfähig. Das liegt nicht nur an der verlorenen Innovationskraft, sondern auch an den zu teuren und zu wenigen Arbeitsstunden.
Der Staat hat den Bürgern in vielen Ländern täglich suggeriert, dass er für alles verantwortlich ist und Arbeit eben nur eine lästige Nebenerscheinung der modernen Wohlfahrtsgesellschaft ist.
Waldmeyer erkennt: Wir haben also Nachholbedarf in der Schweiz. Wir arbeiten zu viel. Wir haben zu wenig Ferien. Auch keinen richtigen Elternurlaub. Wir sind zu wenig krank. Wir müssen uns trotz Menstruation ins Büro schleppen. Und das Schlimmste: Wir arbeiten zu allem noch ganz gerne!
Waldmeyer nahm sich vor, die Psyche der Forderungsprotagonisten aus gewissen grünen und linken Ecken genauer zu studieren: Arbeiten diese vielleicht selbst nicht gerne? Oder ist es tatsächlich nur ihr politisches Spiel, um wiedergewählt zu werden? Oder handelt es sich doch um zwar weltfremde, aber gutmeinende Fundis, die ehrlich an ihre abenteuerlichen Programme glauben?
Waldmeyer dachte dabei auch an seine ältere Schwester Claudia (frühpensionierte Lehrerin, SP, praktischer Kurzhaarschnitt, lustige farbige Brille, altes Nokia). Tatsächlich ist sie der Meinung, mit ihrem heutigen Konsumverzicht, allerdings mit einer komfortablen staatlichen Rente, der Welt Gutes zu tun.
Aber auch Waldmeyer selbst, so stellte er fest, hat schon viel Gutes für die anderen getan: Er hat jahrelang gemalocht, eine Firma aufgebaut, Arbeitsplätze geschaffen und viel Steuern bezahlt. Auch hat er immer tüchtig ausgegeben, der Gesellschaft also das Geld zurückgegeben. Mittels Multiplikatoreffekt hat er tatsächlich die Wirtschaft, wenn auch nur im Nanobereich, angekurbelt.
Wenn die Arbeitskosten zu hoch sind, sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Das schlägt auf das BIP und letztlich auf das verfügbare Einkommen des Bürgers. Die unteren Schichten trifft dies dann bekanntlich überdurchschnittlich. Auch ein flächendeckender Kosumverzicht, das weiss jeder Ökonom heute, würde unsere Gesellschaft in ein Desaster stürzen.
Waldmeyer fasste nun einen Management-Entscheid: Da er nicht mehr voll im Berufsleben steht, möchte er trotzdem weiter etwas für die Gesellschaft tun. Das Beste, was ihm im Moment einfiel, war, seinen Konsum nicht einzuschränken. Ja, der Motor der Wirtschaft muss weiterlaufen, damit die Gesellschaft ihren Bedarf, mit allerlei Spässchen und Forderungen, finanzieren kann. Und Waldmeyer, als winziges Rädchen in diesem Getriebe, wollte dabei sicher nicht als Spassbremse auftreten!
„Charlotte, wir sollten mehr Geld ausgeben“, meldete Waldmeyer zu seiner Frau in ihr Arbeitszimmer rüber.
“Ich hätte eigentlich lieber etwas mehr freie Zeit, Schatz!“, kam es sofort zurück.
Waldmeyer war verwirrt. Die Sache ist offenbar komplizierter. Er nahm sich vor, seinen Ansatz nochmals zu überdenken.