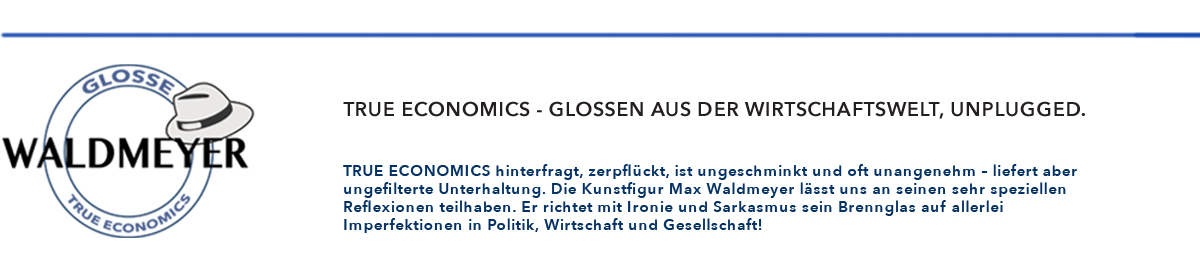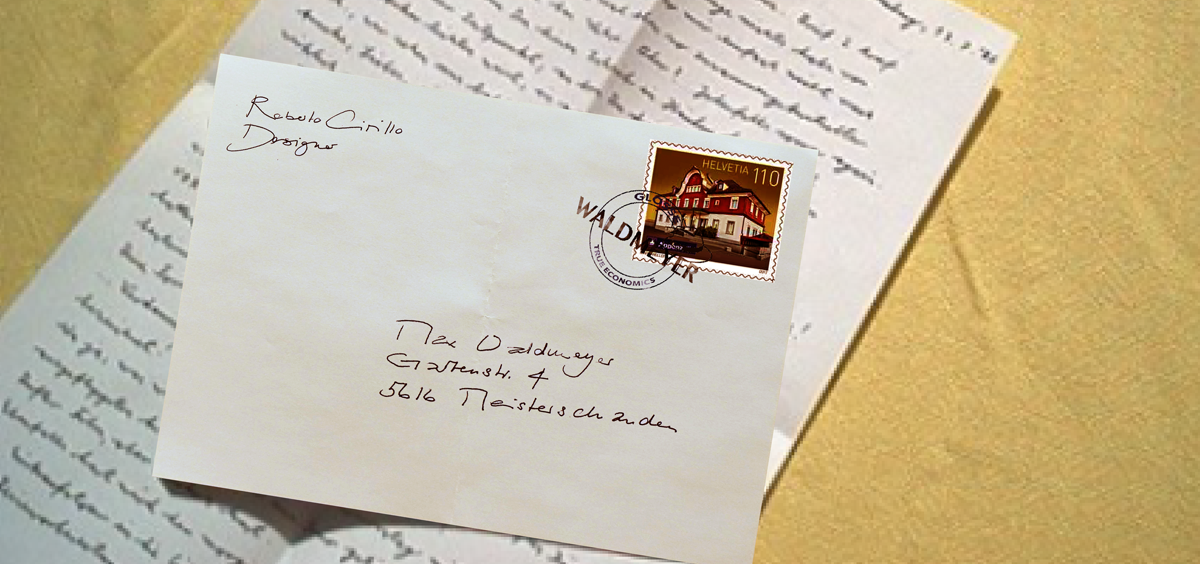Charlotte, kennst du Roberto Cirillo?“, fragte Waldmeyer seine Frau.
„Du meinst den Designer?“
„Nein, den Postchef. Er ist von Beruf Monopolist und erhöht jetzt die Briefpost-Tarife, obwohl keine Sau mehr Briefe verschicken möchte.“
Charlotte hörte bereits nicht mehr zu, als Waldmeyer ihr das Geheimnis der Preis-/Mengenkurve näherbringen wollte. Er tat dies zuerst anhand des Schweizer Taximarktes: Kein Mensch fährt mehr Taxi in der Schweiz. Ausser in einer Notlage. Die Taxipreise in Zürich sind inzwischen die höchsten weltweit; Tokyo, London oder Beverly Hills sind günstiger. Das war nicht immer so. Aber als die Preise (vor Jahren schon) stiegen, wurde plötzlich weniger Taxi gefahren. Und um den Umsatzrückgang zu kompensieren, beschlossen die mit staatlichem Sukkurs kartellmässig organisierten Taxiunternehmer, einfach die Preise zu erhöhen. Heute sieht man nur noch selten Taxis auf der Strasse. In der Regel stehen sie und warten. Alle Taxifahrer könnten während den kumulierten Wartezeiten in ihren Fahrzeugen locker ein Physikstudium bewältigen. Sie tun es indessen nicht, sondern, wenn sie nicht gerade rauchen, warten sie einfach. Für Waldmeyer stellt dies die Inkarnation einer betriebswirtschaftlichen Ineffizienz dar, denn Mensch und Maschine liegen brach.
Nun aber zurück zur Post: Seit dem Jahr 2000 ging die Briefpostmenge um fast die Hälfte zurück. Das liegt unter anderem daran, so überlegte Waldmeyer, dass ältere Menschen, die früher noch Postkarten schrieben, jetzt wegsterben.
Nun werden also zehn Rappen mehr verlangt für einen A-Post-Brief. Sollten wir also alle doch besser definitiv umsteigen auf Mail-Korrespondenz? So oder so: Wieso soll man abends noch mit dem SUV zum Briefkasten fahren und dort einen Brief einwerfen, der trotz A-Post am nächsten Tag nicht ankommt? Schneller, kostengünstiger und umweltschonender geht’s in der Tat per Mail – natürlich. Selbst, wenn es eine Rechnung ist. Die Online-Anbieter machen es vor.
Im ersten Semester Volkswirtschaftslehre durfte Waldmeyer allerlei Basics studieren. So der Trick mit dem Angebot und der Nachfrage, auch die Korrelation von Preis und Menge. Steigt der Preis, geht logischerweise das Verkaufsvolumen zurück. Keine neue Erkenntnis, aber die Makroökonomie versteht es, dies kompliziert darzustellen.
Für Leser, die vielleicht nur humanistisch gebildet sind und nicht durch das Stahlbad einer betriebs- oder volkswirtschaftlichen Schulung gingen: Nun gibt es Güter, die kaum preissensibel sind. Wir duschen z.B. kaum weniger lang, wenn der Wasserpreis etwas steigt. Oder wir tanken immer noch voll, obwohl der Benzinpreis um 10 oder 20% gestiegen ist. Und nun dieses besondere Phänomen der inversen Nachfragekurve: Es beschreibt Güter, deren Preis/Menge sich invers zu jeder Logik verhält. Wenn der Preis erhöht wird, steigt ihre Nachfrage! Bei Louis Vuitton beispielsweise ist das so, bei diesen Plastiktäschchen. Wenn man das geschafft hat, ist man im Olymp des Marketings angekommen. Ja, das ist dann gekonntes Branding. Wenn der Preis für das Täschli sinken würde – z.B. um 95%, also nahe an den Produktionspreis in Fernost (von vermutlich 5% des Endverkaufspreises), dann würde kein Hahn mehr nach den Plastikteilen krähen. Also merke: Auf keinen Fall den Preis senken, wenn das Produkt hip ist!
Nun wieder zurück zur Briefpost: Warum wird denn nun der Preis erhöht, obwohl die Nachfrage zurückgeht? Und warum gerade jetzt, wo der ehemalige Gewerkschafter und SP-Protagonist Daniel Levrat Verwaltungsratspräsident der Post geworden ist? Nun gut, er kam ja auch wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Job, und vielleicht hat er sich mit dem Designer (Cirillo) noch nicht abgesprochen. Vielleicht kam ja sein B-Post-Brief an ihn noch nicht an. Waldmeyer überlegte: Ist ein Brief vielleicht keine profane Taxifahrt, sondern etwas Hippes? Wird der Preis nun erhöht, damit mehr Briefe verschickt werden? Vielleicht unterschätzen wir den Cirillo? Vielleicht hat er einen Geheimplan? Einer mit der inversen Nachfragekurve vielleicht: Briefe verschicken wird bald so cool, dass wir bereit sind, noch mehr dafür zu bezahlen. Ja, und dann würden wir auch wieder mehr Briefe schreiben, klar. Dieser Cirillo, das ist vielleicht der neue Hayek der Post, ein ganz schlauer Hund!