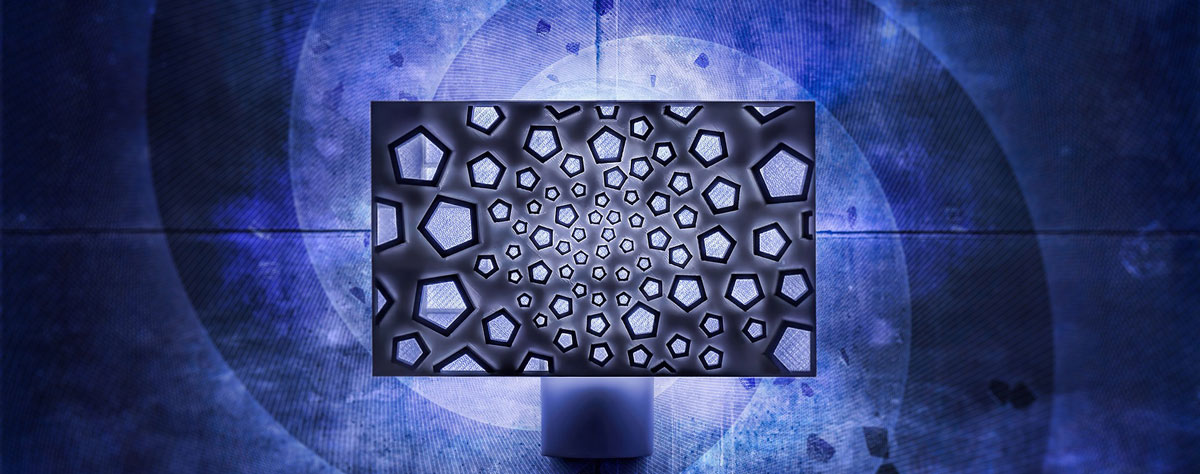Oder: Wohin man auswandern könnte, oder auch nicht
Waldmeyer war seinem Sohn Noa (24, studiert Betriebswirtschaft in Zürich, Freundin: Bekime, albanisch) eine Antwort schuldig. Er wollte ihm einen Auswanderungs-Ort präsentieren, der klimatisch attraktiv ist, wo das Leben günstig ist, und es sollte sich überdies lohnen, dort Geld zu verdienen und zu investieren. Aufgrund der drohenden 99%-Initiative galt es in der Tat, langsam nach Alternativen zur Schweiz Ausschau zu halten. Also warum nicht Albanien? Nur schon wegen Bekime.
Es hätte auch Goa sein können, der Hippieort der Siebziger, die hübsche portugiesische Ex-Kolonie an der indischen Westküste. Oder Nimbin, das Kiffermekka in Australien, nahe dem bekannten Urlaubsort Byron Bay. Oder einfach die USA – mit einer Tellerwäscher-Karriere oder so, wie früher. Waldmeyer wäre indessen nicht Waldmeyer, wenn er nicht out of the box denken würde. Mit einer Prise Provokation natürlich.
Also präsentierte er am nächsten Sonntagvormittag am Frühstückstisch (Noa schien noch etwas eingeknickt, was wohl am Restalkohol lag) seine Albanien-Idee. Albanien ist nämlich ein Geheimtipp: Es ist der verlorene Riviera-Staat am Mittelmeer!
Die drei Millionen Einwohner in dem kleinen Land an der Adria verfügen über ein für Europa rekordverdächtig tiefes Prokopfeinkommen, dreimal kleiner als dasjenige im eh schon gebeutelten Griechenland. Eine Aufnahme in Waldmeyers persönliche Liste der „zivilisierten Länder“ bleibt dem rückständigen und etwas merkwürdigen Nato-Staat damit verwehrt. Beeindruckend ist auch, dass Albanien, pro Kopf gemessen, die stärkste Umweltverschmutzung Europas produziert. Aber Waldmeyer ging es eher um die Faszination des Gedankens, dass Albanien, und das mitten in Europa und am schönen Mittelmeer gelegen, schlichtweg vergessen ging.
An der albanischen Riviera ist das Winterklima mit Griechenland oder Sardinien vergleichbar – nur aus dieser, etwas verkürzten Perspektive müsste man diesen Landstrich also z.B. der Côte d’Azur vorziehen! Und es gäbe hier schon eine absolut stattliche Villa für rund 200‘000 Euro, mit unverbaubarem Meerblick gegen Westen… Überhaupt ist das Leben in diesem vergessenen Land lächerlich günstig, Waldmeyers Index der Lebenshaltungskosten, inkl. Wohnkosten, liegt bei 18% (Zürich: 100%). Selbst die Einkommenssteuern sind gering, zurzeit wird eine Flat Tax von nur 10% erhoben. Und keine Vermögens- und/oder Kapitalgewinnsteuer. Verglichen mit den Zielen der 99%-Initiative also paradiesische Fiskalzustände.
Das Land pflegt eine mediterrane Küche, es verfügt ja auch über 360 km Küste. Die Kriminalität liegt tief, und Gästen im Land wird ausnehmend freundlich und mit Respekt begegnet. Man verständigt sich hervorragend in Italienisch, das Englische ist im Vormarsch. Es gibt auch verschiedene Universitäten, Einkaufen lässt sich problemlos in der Hauptstadt Tirana. Auf dem Markt im Dorf könnte Bekime übersetzen.
Wirtschaftlich liegt das Land aber auf einem traurig tiefen Niveau, hervorragend läuft eigentlich nur der Marihuana-Anbau, v.a. im Süden. Das alles muss jedoch, investitionsmässig, kein Nachteil sein.
Waldmeyer ist nämlich überzeugt: Albanien ist der ungeschliffene Diamant an der Riviera der Adria! In 20 Jahren vielleicht könnte das Land einmal ein Touristen- und Zweitwohnsitz-Hotspot sein.
Waldmeyer fasste auch die History kurz zusammen: Die grosse Wende 1989 ging an Albanien erst spurlos vorüber; unbeirrt verfolgte es seinen stalinistischen Kurs. Es sollte noch bis tief in die 90er Jahre dauern, bis das Land die wirtschaftliche und gesellschaftliche Isolation aufgab. Als Folge davon finden wir nun an dem Küstenstreifen der Adria, gleich gegenüber dem Belpaese, diesen völlig rückständigen Flecken, welcher das Tourismuspotenzial noch kaum erkannt hat.
Noa hatte sich schon längst seinem Smartphone zugewandt, Waldmeyer dozierte weiter: Internet und Mobilfunk seien erstaunlicherweise hervorragend in Albanien. Direktflüge gibt es ab Deutschland und Österreich, von Zürich aus dauert es zurzeit noch 3-4 Stunden, mit Umstieg in Mailand, Zagreb oder Ljubljana. Aber man kann auch hinfahren: In zwei Tagen ist man spielend dort.
Erstaunlicherweise sind auch Zara und H&M – zumindest in Tirana – vertreten. Also ist alles hier.
Der kommunistische Groove wurde noch nicht überall vertrieben, das Land leidet immer noch unter krasser Misswirtschaft und Korruption – könnte sich also noch entwickeln! Albanien macht allerdings nur Sinn, wenn eine persönliche familiäre Bande mit Bezug zum Land besteht. Und genau hier kommt eben die Rolle von Bekime zum Tragen! Denn genau dies könnte nun die logische Motivation sein, das Land fundierter zu prüfen. „Bekime“ bedeutet übrigens „die Gesegnete“. Das passt doch. Ein Segen als Puzzleteil im Gesamtkonzept Albanien. So könnten auch die lästigen Zivilisationsdefizite ausgeblendet und etwas längerfristig geplant werden. Sich frühzeitig nun etwas Eigentum an der albanischen Riviera zu sichern, könnte so zum intelligenten Schachzug werden. Ein kleiner Strandabschnitt gar – für einen Apfel und ein Ei erstanden, notabene – könnte den Grundstein für ein Immobilienimperium am Mittelmeer legen.
Für Waldmeyer selbst kommt das natürlich nicht in Frage – er ist schlichtweg zu alt, der Anlagehorizont übersteigt seine noch angenehm verwertbare Restlebenszeit. Aber Noa könnte das stemmen, er verfügt locker über einen Anlagehorizont von mindestens 30 Jahren. „Das ist natürlich ein sehr langfristiger Anlagetipp!“, schloss Waldmeyer seine umfassende Länderpräsentation.
„Dad, Bekime ist doch nur friend with benefit. Einen Teufel werde ich tun und mich nach Albanien verkriechen! Zudem möchte Bekime nie mehr nach Albanien zurück. Dann noch eher nach Nimbin!“
Damit war diese Perle am Mittelmeer wohl vom Tisch. Aber das mit Nimbin machte Waldmeyer nun doch etwas Sorgen.