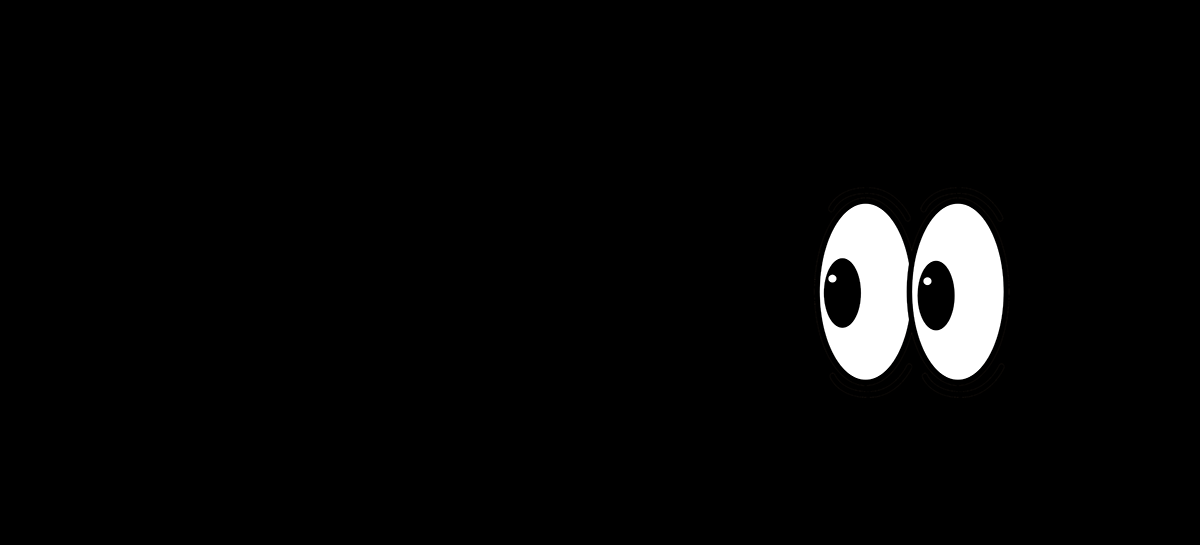Oder wie man mit mikroökonomischen Erlebnissen im Dschungel umgeht – wieder einmal eine wahre Waldmeyer-Geschichte
Max Waldmeyer blickte, vom Sofa aus, über den Hallwilersee. Oder starrte zumindest dorthin, wo dieser unter dem Nebel liegen sollte. Die Coronazeit brachte es mit sich, dass man nicht gross reisen kann. Aber zumindest lassen sich vergangene Reisen umso schöner Revue passieren. Waldmeyer erinnerte sich so an sein Dschungelerlebnis, es war 1998. „Jogjakarta war schon sehr beeindruckend“, meldete Waldmeyer zu Charlotte rüber. Indonesien ist im Moment ohnehin brandaktuell – wegen der Palmöl-Geschichte und so, ein für die Schweiz vermutlich überlebenswichtiger Staatsvertrag.
In der Tat hatte Waldmeyer im indonesischen Jogjakarta ein persönliches Schlüsselerlebnis. Subjektiv sogar viel prägender als dieses geplante indonesisch-schweizerische Mickymaus-Abkommen.
„Eigentlich wolltest du damals ja nur nach Bali“, meinte Charlotte überrascht. Das war richtig. Waldmeyer, zu jenem Zeitpunkt noch in einer delikaten CEO-Position, sehnte sich eigentlich nur nach ein bisschen Erholung. Also bot sich, zum Beispiel, Bali an. Flugbashing gab es damals, vor gut 20 Jahren, noch keines und Pandemien waren noch nicht erfunden. Also konnte man beschwingt auch längere Reisen antreten. Es war sogar Charlotte, welche die Reisestrecke gar noch verlängerte; sie überredete Max zu einer ziemlich ausgedehnten Indonesien-Rundreise. Und erst am Schluss dann Bali. Es kamen einige Tempel zusammen.
Es geschah im Raum Jogjakarta: Hinter der sehr schönen Hotelanlage lag dieser Dschungel-Treck. Gleich am ersten Morgen machten sie sich auf den Weg. Max stapfte voraus. Alles sehr feucht, alles sehr grün, alles sehr dunkel.
Plötzlich sprang ein ebenso dunkler Einheimischer hinter einem dieser dunklen Bäume hervor. Waldmeyer erschrak, Charlotte noch stärker. „Gudmoninsir“, begrüsste er beide. Parthorasan (nennen wir ihn so), präsentierte, fein säuberlich über seinen Unterarm gehängt, dunkle lange Socken. Es waren die Art Business-Socken, die kurze Zeit später, 1999, von diesem Startup Blacksocks im Abonnement angeboten wurden. Schwarze Kniesocken, Baumwolle, braucht man immer. Aber warum nur, um alles in der Welt, bot sie Parthorasan gerade hier im Dschungel zum Verkauf an? Waldmeyer war auf jeden Fall tief beeindruckt. Dieser Mensch musste offenbar durch ein besonders hartes Stahlbad von Sales-Trainings gegangen sein. Schwarze Kniestrümpfe im tropischen Urwald anzubieten war in der Tat eine Leistung!
Überhaupt, reflektierte Waldmeyer weiter, wird „Sales“ unterschätzt. „Sales“ ist ja nicht einfach „Verkauf“. In der Businesswelt, insbesondere in der Konzernwelt, wird „Sales“ berechtigterweise sehr hoch eingestuft, dort ist dann „Sales“ sogar „Corporate Sales“. Karrieremässig überrunden die Sales-Manager oft die Marketing- und Finanzfritzen. Sales ist in der Regel hart, deshalb hatte Waldmeyer grösste Achtung vor diesen professionellen Sales-Leuten. Parthorasan gehörte genau in diese Kategorie. Für das anspruchsvolle Verkaufen braucht es nämlich Selbstvertrauen, Mut, Überzeugungskraft, auch Überraschungseffekte. Sales ist eben auch Psychologie in der Endstufe.
Der Nebel in Meisterschwanden und über dem See lichtete sich immer noch nicht. Charlotte riss Waldmeyer aus seinen Gedanken: „Max, warum hattest du damals gleich sechs Paar von diesen Socken gekauft?“
„Stimmt“, antwortete Waldmeyer. „Angebot und Nachfrage waren eigentlich nicht im Einklang. Es war ein Fehler, ich hätte verhandeln sollen. Preis/Menge stimmten nicht.“
Charlotte war nur partiell zufrieden mit der Antwort. Aber es war ihr eigentlich auch gleich. Hauptsache, Max hatte die Socken später nicht am Hotelpool getragen.
Was blieb, so für Waldmeyer, war der Respekt vor diesen harten Sales-Jobs. Unmögliches möglich zu machen, das sind wahre Leistungen!
Aber eigentlich war die ganze Sockengeschichte ziemlich irrelevant. Wohl genauso irrelevant wie diese Abstimmung betreffend dem Freihandelsabkommen mit Indonesien, fasste Waldmeyer für sich zusammen. Zumal das Palmöl zum grössten Teil nämlich gar nicht aus Indonesien, sondern aus Malaysia kommt. Ob es dort auch Sockenverkäufer gibt?