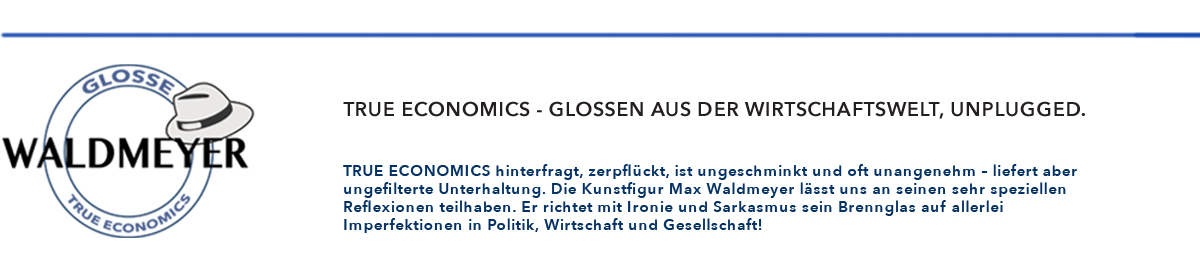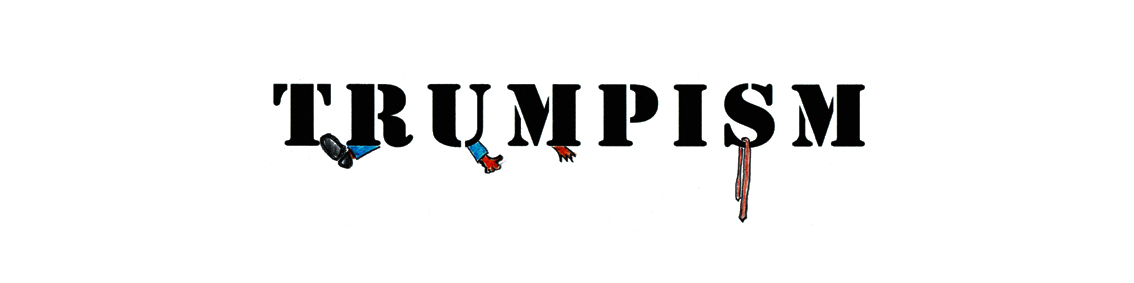Die Trends waren schon seit ein paar Jahren ziemlich eindeutig, bedingt durch tiefe Zinsen, neue Wohnansprüche und die Digitalisierung. Corona bringt nun eine Akzentuierung und zusätzliche Verschiebungen ins Spiel. True Economics untersucht fünf Märkte, bzw. Anlageformen: Gewerbeliegenschaften, Büroliegenschaften, Mietwohnungen, Wohneigentum und Immobilienfonds. Wo soll der smarte Investor noch investieren? Die Antwort hier gleich vorweg: Es kommt zurzeit nur noch eine einzige Anlageform in Frage!
Zu unserer Auslegeordnung gehört, dass wir 4 Megatrends beobachten, welche von weiteren 4 Corona-bedingten Trends verstärkt oder gestört werden:
Megatrend Nummer 1: Zinsen auf Tiefstand befeuern die Preise für Wohneigentum
Erst recht in der Folge der weltweit explodierenden Staats-Verschuldungen werden nun die Zinsen auch längerfristig tief bleiben. Das Welt-Finanzsystem würde schlichtweg kollaborieren, müssten die Staaten rund um den Globus nun nächstens mit Zinserhöhungen rechnen. Auf absehbare Zeit werden wir also keine Zinsen mehr sehen. Ergo lohnt sich Verschulden auch längerfristig – ob privat oder institutionell. Die gesunde Nachfrage nach Wohneigentum wird damit anhalten, die Immobilienpreise werden kaum sinken.
Megatrend Nummer 2: Anlagenotstand der Pensionskassen beeinflusst den Mietwohnungsmarkt
Aufgrund mangelnder Rendite-Alternativen wird weiter in Immobilien investiert. Das absehbare Überangebot wird jedoch auf die Renditen für Investitionen in Mietwohnungen drücken.
Megatrend Nummer 3: Es braucht weniger Büroflächen
Digitalisierung und flexibleres Arbeiten führen tendenziell zu weniger Bedarf an Büroflächen. Das drückt auf die Preise.
Riesige Grossraumbüros werden wohl der Vergangenheit angehören. Die Firma IBM hatte uns bereits vor 20 Jahren schockiert, als sie die festen Arbeitsplätze abschaffte und durch individuelle Rollcontainer ersetzte, welche beim Eingang der Büros gefasst werden konnten. Natürlich wurde dies zum grossen Teil wieder rückgängig gemacht. Aber seit ein paar Jahren setzt sich ein Trend zu Homeoffice durch – selbstredend nicht nur bei IBM.
Zudem dämmert bei vielen Firmen langsam die Erkenntnis, dass es in der Tat absurd ist, einzelne Büros oder eine grosse Anzahl an Arbeitsflächen zu unterhalten, wenn diese gar nicht ausgelastet sind (weil sich Mitarbeiter im Markt draussen oder im Homeoffice befinden). Für die Aussendienst-Sitzung am Montag braucht es z.B. keine speziellen Büros mehr. Weniger Raum für klassische Arbeitsplätze ist also gefragt, mehr Raum für Teambildung, Newsrooms, Räume für Besprechungen und Koordination, zuschaltbar auch für Externe. Das Prestige des Einzelbüros verblasst, der Status der elektronischen Vernetzung kompensiert.
Ausserdem setzen sich neue Büro-Nutzungsformen durch: Multifunktionalität von Räumen, Split-Offices, flexible Büroflächen, Co-Working-Spaces. Nicht der einzelne Arbeitsplatz hat mehr Planungs-Priorität, sondern die digitalen Kommunikationsmittel und das Daten-Management, welche künftig den Raumbedarf definieren.
Alles nicht neu und nicht überraschend? Vielleicht. Aber neu ist die Nachhaltigkeit dieses Trends, ein Point of no Return.
Das Resultat: Es braucht auch längerfristig weniger Büroflächen, jedoch modernere Strukturen, welche wiederum besser durch modernere Gebäude geschaffen werden. Also geraten die Preise und Mieten für klassische Büroflächen noch weiter unter Druck. Und der Druck wird anhalten, denn die Umnutzung des Überangebotes dauert eine Ewigkeit.
Megatrend Nummer 4: Gewerbeflächen unter Druck
Der Onlinehandel senkt die Nachfrage nach Retailflächen, die überhöhten Mietpreise der letzten Jahre werden stark korrigiert. Im verarbeitenden Gewerbe und der Industrie (oder zumindest was davon übrig geblieben ist in der Schweiz) ist ebenso ein nachhaltiger Umbau festzustellen. Roboterisierungen befeuern den Trend zusätzlich. Roboter müssen übrigens keine Distanz halten und auch keine Masken tragen…
Die Digitalisierung wird die De-Industrialisierung weiter fördern. Der bisherige Bedarf an Gewerbeflächen im herkömmlichen Sinne (für Einzelhandel, Gewerbe und Industrie) wird sich kaum mehr ausweiten – und damit kommen auch in diesem Bereich die Preise weiter unter Druck.
Trend Nummer 5 (Nach-Corona-Trend): Wohnansprüche verändern sich
Die Corona-Pandemie hat uns sehr gut vor Augen geführt, wie wertvoll schönes Wohnen sein kann. Also nicht zu beengt, vielleicht im Grünen, vielleicht mit Garten – oder zumindest mit Balkon, Terrasse. Schon jetzt ist diesbezüglich ein neuer Nachfrage-Trend auszumachen. Das Leben zuhause wird wichtiger, die urbaneren Lebensformen – mit extensivem Ausgehen, auswärts Essen, etc. – sublimierten sich vorübergehend quasi über Nacht. Also doch lieber raus aufs Land…? Der kurzfristig auszumachende Trend zur Korrektur der Wohnansprüche könnte sich als ein nachhaltiger herausstellen, wenn die Pandemie-Auswirkungen noch länger andauern.
Diese Beobachtung konzentriert sich übrigens nicht nur auf die Schweiz. In den USA ist ein klarer Trend zu mehr Nachfrage nach ländlicherem Wohnraum auszumachen. Oder ein weiteres kosmopolitisches Beispiel: In Dubai ist ein starker Trend zu Villen mit Garten zu verzeichnen, weg von den chicen urbanen Apartments. Eine Momentaufnahme nur? Wir glauben nicht, denn dafür wird die Krise zu lange dauern.
Trend Nummer 6 (Nach-Corona-Trend): Homeoffice verändert den Markt
Mehr Homeoffice bedeutet nicht nur weniger Bedarf an Büroflächen. Parallel wird sich auch der Bedarf nach mehr Wohnraum entwickeln.
Immer mehr Firmen werden diesen Trend stützen. Techfirmen entschädigen ihre Mitarbeiter bereits für Homeoffice: für Geräte, Büromöbel oder Büroraum. Durch den Wegfall des Pendelns ergeben sich individuell zudem nicht nur geografisch neue Wohnoptionen, sondern die ökonomischen Einsparungen werden mit Sicherheit auch in mehr Wohnraum investiert werden.
Die Schleusen für mehr Homeoffice wurden Corona-bedingt geöffnet. Trotzdem werden dieser Entwicklung Grenzen gesetzt. Es geht dabei nicht nur um die Überlegung, dass ganze Sektoren der Wirtschaft davon ausgeschlossen bleiben. Grenzen setzen auch die Pflege der Unternehmenskultur, der Verlust von Teambildung, von Innovationsentwicklung und sozialem Austausch. Letztlich geht es auch um Fragen der Führung. Aber es bleibt trotz dieser Grenzen ein Trend, der auf mehr Wohnraum hinweist, allenfalls auch – unter anderem preisbedingt – auf weniger urbane Nachfrage.
Trend Nummer 7 (Nach-Corona-Trend): zu viele Miet- und Investitionsobjekte im Gastronomie und Tourismus.
Diese Branchen werden noch Jahre brauchen, bis sie sich wieder – auf welchem Niveau dannzumal auch immer – aufgerappelt haben. Mietzinse und Preise für die betroffenen Liegenschaften verzeichnen starke Rückgänge; diese werden weiter sinken. Es trifft vor allem Gastronomie, Hotellerie und generell den Tourismus der Innenstädte. Umnutzungen werden unumgänglich werden, sofern überhaupt realisierbar, und Mietzinse und Objektpreise werden für längere Zeit im Keller bleiben.
Ein gegenteiliger Trend könnte sich für Ferienimmobilien in der Schweiz entwickeln. Aber das sind nur erste Vermutungen und wird von der Dauer der Pandemieeffekte abhängen.
„Nicht-Trend“ Nummer 8: Corona drückt auf die Preise für Wohneigentum?
Zu Beginn der Krise wurde vermutet, dass die höhere Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Unsicherheit und/oder die Erhöhung der Sparquoten auf die Nachfrage und damit auf die Preise für selbst genutzte Wohnobjekte drücken könnten. Die Tragbarkeit für die Finanzierung von Wohneigentum könnte in vielen Fällen neu kalkuliert werden und den Investitionsspielraum einschränken. So könnte ein Trend zu kleineren Wohnungen einsetzen (aufgrund von Einkommensreduktionen, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Unsicherheit).
Bis jetzt sind allerdings solche Effekte kaum auszumachen – oder sie werden von andern Effekten überlagert, wie der Wunsch nach mehr Wohnraum. Und vor allem: wenn, dann handelt es sich nicht um einen „systemischen“ Trend, sondern um eine mehr oder weniger einmalige Erscheinung.
Zweiteilung des Wohnungsmarktes
Am wichtigsten für uns als Investoren ist die Erkenntnis, dass zurzeit eine klare Zweiteilung des Wohnungsmarktes stattfindet. Seit einigen Monaten hat sich der Mietwohnungs-Markt vom Wohneigentums-Markt abgekoppelt.
Dahinter steckt vor allem der Umstand, dass institutionelle Anleger, vor allem die Pensionskassen, nur anlegen wollen; sie verstehen den Handel mit Immobilien nicht. Sie kaufen nicht auf, um umzunutzen, zu renovieren und anschliessend wieder zu verkaufen – mit dem dazugewonnenen Agio. Unter “Entwicklungsprojekten“ verstehen sie i.d.R. nur das Erstellen von Neubauten. Sie wagen sich z.B. nicht an Altbauten oder an schöne Industriebrachen, welche aufgewertet und/oder zu attraktiven Wohneinheiten umgebaut und anschliessend wieder dem Markt übergeben werden könnten – zur Vermietung, oder, erst recht nicht, zum Verkauf. Sie erstellen lieber eine 0815-Überbauung an einer Kantonsstrasse. Diese erzielt dann allerdings nur eine dünne Rendite oder produziert zu allem Übel noch Leerstände. Diese Fehlentwicklung wird sich künftig noch akzentuieren.
Aber der Investitionshunger hält trotzdem an. Es wird in zu viele neue Projekte investiert, welche der Mietermarkt nicht mehr absorbieren kann: Der Druck auf die Mieten und damit auf die Rentabilitäten von Wohnliegenschaften ist seit einem guten Jahr auszumachen. So lange die Zinsen jedoch tief bleiben – also noch sehr lange – wird die Umschichtung von institutionellen Anlagen aus Obligationen in Immobilien weiter anhalten. Die regelmässigen Mieteinnahmen einer Renditeliegenschaft scheinen immer noch genügend attraktiv zu sein, auch wenn sich die Renditen in einzelnen Regionen langsam bei unter 2% einreihen. Kommt es zu einem Crash? Zumindest für Mietwohnungsanlagen ist dies nicht auszuschliessen. Mittelfristig – als Crash-Alternative vielleicht? – könnte ein Shift von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen erwartet werden. Das wäre die eleganteste Lösung, um den Überbestand in einem Markt mit einem Unterbestand im andern Markt zu kompensieren. Dafür müsste allerdings der Druck auf den Markt noch stärker werden – deshalb wohl nur ein mittelfristiges Szenario. Im Moment machen offenbar Einzelverkäufe von Wohneinheiten von Institutionellen an Private (also die Mutation von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen) keinen Sinn. Die Einmalgewinne locken kaum, die frei gewordenen Mittel müssten wieder mühsam parkiert werden – wieder in Immobilien…
Der zweite Treiber dieser Abkoppelung liegt im Umstand, dass es offenbar zu wenig private Investoren gibt, welche grössere Liegenschaften oder Siedlungen erstellen, um sie dann (gewinnbringend) in Einzelteilen in Form von Eigentumswohnungen, Reihenhäuser oder freistehenden Häuser im Markt zu platzieren.
Der Investitionswille von Individuen für den Erwerb von Wohneigentum ist auf jeden Fall ungebrochen. Geld kostet nichts, und so bleibt kaufen günstiger als mieten.
Damit ergeben sich für den smarten Investor folgende Konsequenzen:
1. Markt für Gewerbeimmobilien: Hände weg
Die grosse Korrektur kommt erst noch. Es wird eine weitere Wertvernichtung stattfinden.
2.Markt für Büroflächen: Hände weg
Es braucht künftiger weniger Büros, trotzdem befinden sich noch Projekte in der Pipeline. Die Preise werden weiter sinken.
3. Markt für Wohnliegenschaften: Hände weg
Pensionskassen überfluten den Markt mit neu erstellten Mietwohnungen.
4. Immobilienfonds: Hände weg
Die meisten Fonds sind toxisch, da diese viele Gewerbe- und Büroflächen enthalten oder demnächst auf einem Überbestand an Mietwohnungen sitzen bleiben. Die effektiven Preise dieser Liegenschaften hinken den realistischen Bewertungen hinterher, denn die meisten auslaufenden Mietverträge werden später auf einem tieferen Niveau abgeschlossen werden – was unweigerlich zu Tieferbewertungen der Liegenschaften und damit der Fondswerte führen wird.
5. Markt für Wohneigentum: kaufen
Der Markt ist in den meisten Regionen ausgetrocknet. Wohnen wird künftig nicht billiger werden – allein schon, weil Geld nichts kostet. Der Nachfrageüberhang drückt zwar die Preise etwas nach oben. Aber, die gute Nachricht: Hier findet kaum Spekulation statt. Die Nachfrage ist echt, das Angebot einfach zu klein – die Preise werden sich also demnächst nicht stabilisieren. Den Corona-Einbruch hat es nicht gegeben, und es wird ihn wohl auch nicht geben. Im schlimmsten Fall wäre eine vorübergehende Minikorrektur in einzelnen Segmenten zu erwarten. Also lohnt sich der Kauf von Einfamilienhäusern oder Wohnungen an guten Lagen selbst dann, wenn der Preis etwas hoch erscheint. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Was schön ist: Wir können ziemlich sicher sein, dass das Geld kaum teurer wird. Die Tiefzinsphase wird noch sehr lange anhalten, also hängt kein Damoklesschwert von plötzlich hohen Hypothekarzinsen über uns.
Der Staat schläft
Eine ziemlich elegante Lösung, um mehr Angebot an Wohneigentum zu schaffen, wäre die forcierte Umzonung von Industrie- und Gewerbeflächen in Wohnflächen – und zwar möglichst zu Wohneigentum, nicht zu Mietobjekten. Grössere Einheiten an ungenutzten Flächen liegen heute quer durchs Land brach; sie wären zudem relativ preiswert, da die Lagen oft dezentral sind. Das wären oft attraktivere Lösungen als die vielen Neubauten an schlechten Lagen, in tristen Agglomerationen, an lärmigen Strassen. Nur der Staat könnte solche Umzonungs-Lösungen fördern. Bis heute scheint aber noch kein Rezept gefunden zu sein, wie man hier Entscheidungsprozesse von Politik und Staat beschleunigen könnte. Umzonungen sind in der Schweiz nach wie vor politische Endlosspiele, die Jahre und Jahrzehnte verschlingen. Umso schwieriger wird es für den smarten Investor, in diesem Bereich private Projekte zu lancieren.
Fazit:
Von privaten Investitionen in Gewerbe- oder Büroliegenschaften, aber auch in Wohnliegenschaften zu Anlagezwecken ist zurzeit abzuraten – deshalb ebenso in Immobilienfonds.
Es verbleiben einzig Investitionen in Wohneigentum zur Eigennutzung. Oder überschaubare Transformationsprojekte, welche Mehrwert generieren und anschliessend wieder abgestossen werden können. Hier wären Kapitalgewinne auszumachen – aber kaum mehr Gewinne auf Renditebasen.
Die gute Nachricht: Die Bewertungsblase im Immobilienmarkt betrifft vor allem Mietwohnungsanlagen, nicht aber Eigenheime und Eigentumswohnungen. Also jetzt doch noch kaufen – es wird auf absehbare Zeit nicht günstiger werden!