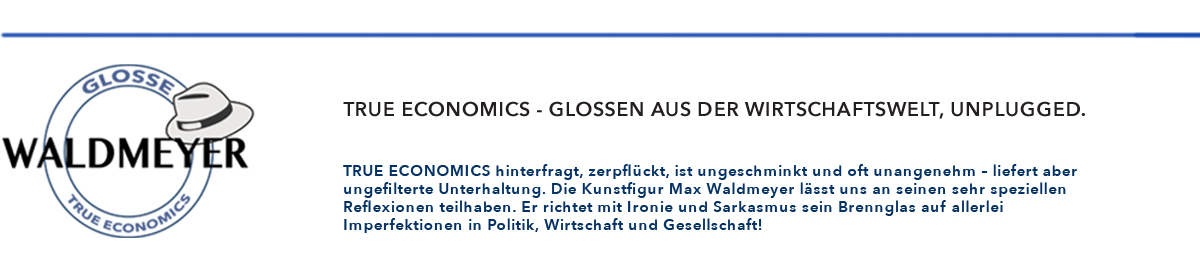Oder: Warum uns der helvetische Agrarluxus pro Jahr 21 Milliarden kosten soll
Wenn man das teure Prinzip der helvetischen Landwirtschaft in Frage stellt, begibt man sich automatisch in ein besonders tückisches Minenfeld. Nun, tun wir‘s trotzdem! Unser Vorschlag also: Die derzeitige Landwirtschaft gehört abgeschafft. Sie kostet unsere Volkswirtschaft jährlich Milliarden und ist ineffizient. Mit dem Einsatz von fünf Franken erzielen wir einen Output von einem einzigen Franken. Hallelujah. Ein Anachronismus, der dringend durch ein zielorientierteres System ersetzt werden muss.
21 Milliarden für die Landwirtschaft
Soviel kostet uns laut Avenir Suisse die Schweizer Landwirtschaft: CHF Mia 20.7 pro Jahr. Ein wahrlich teurer Luxus. Zölle, nicht-tarifäre Importrestriktionen, Subventionen, Direktzahlungen, andere Beiträge, Vergünstigungen, eine aufgeblähte Verwaltung, Planwirtschaft, viele Folgekosten: So kommen in der Tat fast 21 Milliarden Schweizerfranken an direkten und indirekten Kosten zusammen.
Heute arbeiten nur noch 150‘000 Beschäftigte im Agrarsektor – auf Vollzeit umgerechnet sind es bescheidene 2.5% von 5.1 Mio Beschäftigten im Land. Es läppern sich schwindelerregende CHF 200‘000 pro Beschäftigten zusammen, sofern wir die Gesamtkosten tatsächlich auf die Belegschaft umrechnen.
Absurde Geldvernichtung
Noch absurder wird der Vergleich, wenn wir den BIP-Beitrag der Landwirtschaft (nämlich nur 0.6%) ins Verhältnis zu den 21 Milliarden Kosten setzen: Wir setzen also tatsächlich 21 Milliarden ein, um einen landwirtschaftlichen Output von rund 4 Milliarden zu erzielen!
Diesen Vergleich scheint bis heute noch niemand gewagt zu haben, True Economics tut es. Offenbar scheinen diese Zahlen einfach nicht sozialverträglich zu sein?
Tatsache ist, dass das staatliche Manna, das über der Landwirtschaft ausgeschüttet wird, sowohl unsere Staats-, also auch unsere Lebenshaltungskosten deutlich verteuert. Leider wird deshalb auch unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt.
Warum unterstützen wir die Landwirtschaft mit diesen Unsummen?
Zusammenfassend sind – jetzt einmal ganz unwissenschaftlich, unpolitisch und nur gefühlt – insgesamt fünf Ziele für dieses groteske Tun auszumachen:
- Autonomie betreffend Nahrungsversorgung
- Die „Qualität“ der Lebensmittel muss gewährleistet werden
- Der Wunsch nach „Landschaftsgärtnern“
- Die Landwirtschaft muss als touristisches Juwel gepflegt werden
- Und überhaupt
Etliche Sünden in der Landwirtschaftspolitik
An irrwitzigen Beispielen mangelt es kaum. Beispiel Nummer 1: Der Tabakanbau im Tessin wird subventioniert und die Tabakimporteure dazu verdonnert, den mehr als mittelmässigen Schweizer Blend den in der Schweiz verkauften Tabakwaren zwangs-beizumischen. Gleichzeitig wird viel Geld für Anti-Raucherkampagnen eingesetzt, und die AHV darf von den Tabaksteuern profitieren.
Beispiel Nummer 2: Fast amüsant erscheinen die Beträge des Bundes für besonders intelligente Werbekampagnen zur Konsumsteigerung von Schweizer Fleisch (Betrag 2018: fünf Millionen CHF). Gleichzeitig investieren gewisse Bundesämter Geld für Aufklärungsarbeiten zur Reduktion des Fleischkonsums.
Beispiel Nummer 3: Der Bund fördert den biologischen Anbau und die ökologisch saubere Tieraufzucht mit massiven Summen. Gleichzeitig reduziert er für die Bauern die Mehrwertsteuer auf (schädlichen) Pflanzenschutzmitteln.
Beispiel Nummer 4: Der Anbau von Zuckerrüben wird durch den Staat grosszügig gefördert – gleichzeitig laufen teure Kampagnen zur Reduktion des Zuckerkonsums.
Beispiel Nummer 5: Der Weinanbau wird ebenso kräftig gefördert, als ob beispielsweise die Fendant-Produktion im Wallis systemrelevant wäre (wobei anzumerken wäre, dass die Walliser den regelmässigen Konsum ihres mittelmässigen Weissweins tatsächlich als schützenswertes Kulturgut betrachten.) Wie dem auch sei, nebst der Produktionsförderung von Alkohol versucht der Staat gleichzeitig dessen Genuss einzudämmen – mit erheblichen Ausgaben.
Beispiel Nummer 6: Mit zum Teil absurd hohen Zöllen wird der Import von ausländischen Nahrungsmitteln zum Teil regelrecht abgewürgt. An Zöllen bringt dies verhältnismässig wenig ein, denn wenn Importe massiv unterbunden werden, fallen die Zölle gar nicht an. Der Trick mit den Zöllen erinnert uns an den unseligen deutschen Finanzminister Steinbrück, als er das Gleichnis der Kavallerie benutzte, die gar nicht erst ausreiten muss.
An allen Fronten sind also sowohl teure Förderungen, als auch teure Eindämmungen auszumachen. Die Logik würde es gebieten, auf beiden Seiten einfach massiv den Rotstift anzusetzen.
Doch zurück zu den eingangs aufgeführten fünf landwirtschaftlichen Zielen:
Zu Argument 1: Autonomie
Während der Pandemiekrise wurden verschiedene Stimmen laut, welche mehr „Autonomie“ für unsere Nahrungsmittelbeschaffung forderten. Eigentlich forderten sie nur mehr Landwirtschaft. Ob sie wohl an eine Anbauschlacht wie im 2. Weltkrieg dachten? Vielleicht sollten also mehr grosse Anbauflächen bereitgestellt werden, um die Autonomie zu gewährleisten? Aber wo…? Es bräuchte nämlich eine ziemlich grosse Zahl von km2 für Getreide, Gemüse und Obst. Eine solche Autonomie wäre – theoretisch – nur realisierbar, wenn wir auf die flächenintensive Fleischproduktion verzichten und auf jedem freien m2 Kartoffeln anbauen würden.
Fakt ist nun mal, dass die „Graue Agrarfläche“ (die theoretische Anbaufläche, die wir für die Produktion unserer Lebensmittelimporte im Ausland beanspruchen) deutlich grösser ist als die eigene. Eine Autonomie wäre also unmöglich. Sie würde auch zu einem ökologischen Gau führen, die Ausbeutung der letzten Böden mit Einsatz von viel Wasser, Energie und nötigen Düngern und Pestiziden wäre ein Albtraum. Was wohl das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL dazu meint?
Die meisten Produktionsmittel der Bauern werden heute übrigens importiert. So zum Beispiel der überwiegende Teil der Futtermittel. Soviel also zur autonomen Versorgung.
Natürlich wird die „Systemrelevanz“ vorgeschoben, wenn es um den Schutz der Landwirtschaft geht. Die nicht realisierbare Autonomie und die heute einfach nicht mehr umkehrbare Abhängigkeit von ausländischen Produzenten für Saatgut, Produktionsmittel, Dünger, Mittel zur Schädlingsbekämpfung und letztlich fertigen Nahrungsmitteln muss einfach akzeptiert werden – alles andere ist blauäugig. Oder eben politisch motiviert.
Wir wären in der Schweiz nicht einmal mehr fähig, unser eigenes Bier zu brauen: Da wäre in der Tat Hopfen und Malz verloren (denn beide Produkte müssen fast zur Gänze importiert werden).
Die „Sicherung der Landesversorgung“ kann einzig gewährleistet werden, indem grössere Pflichtlager gehalten werden und die Beschaffung im Ausland diversifiziert wird, um nicht in lokale Abhängigkeiten zu geraten.
Fazit: „Unsere“ Landwirtschaft gibt es schon lange nur noch partiell, die Autonomie ist eine Illusion.
Zu Argument 2: Qualität
Nur Schweizer Produkte garantieren für Qualität – so die vorherrschende Meinung an vielen Orten. Schweizer Fleisch zum Beispiel sei einfach per se besser. Unsere Produkte sind sauberer als die importierten, unsere Aufzucht tiergerechter. Es geht um den Bevölkerungsschutz – was soweit in Ordnung wäre. Qualität kann indessen nicht nur mit eigener Produktion erzielt werden, sondern auch mit Qualitätsnormen, welche für den Verkauf gelten. Wir wollen in der Tat keine Chlorhühner oder mit Antibiotika vollgepumpte Filets. Aber das lässt sich mit Deklarationspflichten und Qualitätsstandards beim Verkauf regeln. Dazu braucht es nicht einmal Importrestriktionen – eine politisch eh immer heikle Angelegenheit.
Fazit: Das Qualitätsargument ist nur ein vordergründiges.
Zu Argument 3: die Landschaftsgärtner
Es stimmt: Jemand muss die Wiesen mähen, die Wälder pflegen, die Bäume zurückschneiden. Aber dafür müssen nicht 200‘000 CHF pro Kopf ausgegeben werden. Flächenbeiträge für die Pflege der Landschaft würden nur einen Bruchteil kosten. „Landschaftsgärtner“ könnte doch ein angesehener Beruf sein! Beitragsempfänger könnten nicht nur Bauern oder grosse Landbesitzer sein – sondern auch Kooperationen oder andere pflegewillige Individuen oder Institutionen.
Fazit: Das Argument zieht einfach nicht, das Problem – so denn eines bestünde – lässt sich lösen.
Zu Argument 4: touristisches Juwel erhalten
Dieses Argument wird oft ins Feld geführt. Es lässt sich selbstredend kaum quantifizieren, und eigentlich könnte es in Argument 3 untergehen: Ja, ein gewisses landwirtschaftliches Image zu pflegen ist dem touristischen Gesamtbild der Schweiz sicher nicht abträglich. Aber wieviel darf dies kosten? Wir würden von einer Fraktion der Subventionssummen sprechen, wenn es nur darum ginge, für die Chinesen und Inder ein bisschen Heidi zu spielen. Schön adrett sollten die Wiesen aussehen, die Fassade des Bauernhofes müsste gepflegt sein, ein bisschen Vieh müsste rumstehen.
Fazit: Falls dieses Argument wirklich wichtig sein sollte, liessen sich Lösungen bestimmt günstiger finden.
Zu Argument 5: und überhaupt
Hier das vielleicht wichtigste Argument: Es geht ums Prinzip. „Wir müssen doch eine anständige Landwirtschaft haben“. „Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Pfeiler unserer helvetischen Demokratie“. „Für unsere Bauern sollten wir schon etwas tun.“ Dahinter stecken oft eine falsch verstandene Heimatliebe und die im Parlament über-repräsentierte Landwirtschaftsbranche. Deren Lobby ist stark und setzt sich im Bundeshaus meistens durch.
Zudem verursacht die Agrarbürokratie in jedem Kanton und beim Bund leider immense zusätzliche Kosten.
Oft geht es nur um Partikularinteressen oder um „Switzerland first“ – und Nostalgie. Vorgeschoben wird, wie so oft in letzter Zeit, die Systemrelevanz.
Fazit: Mit Heimatliebe lässt es sich nicht rechtfertigen, 21 Milliarden auszugeben.
Gefährliche Suggestivfragen
Befragungen in der Bevölkerung resultieren in der Regel zugunsten der Landwirtschaft. Man kann einfach nicht gegen die Bauern sein… Sollte man nicht auch die Krokodile besser schützen? Wer möchte denn wirklich dagegen sein…?
Suggestivfragen führen oft zu einem wenig überraschendem JA, wenn nach „höherem Selbstversorgungsgrad“ geforscht wird. Würde man die Frage stellen, ob die Landwirtschaft CHF 200‘000 pro Beschäftigten kosten darf, so wäre die Antwort allerdings mit Sicherheit ein dickes NEIN.
Die Umweltschleuder Landwirtschaft
Oft geht vergessen, dass unser Agrarsektor einer der ganz grossen Energieverschwender ist. Zudem ein grosser Umweltverschmutzer: Schweizer Traktoren und alle landwirtschaftlichen Geräte zum Beispiel dürfen dreckig sein, sie sind von strengen Abgasnormen praktisch ausgenommen. Ein grosser Teil der Wasserverschmutzung geht auf den Einsatz von Pestiziden und der zum Teil massiven Düngung zurück.
Ineffiziente Betriebsgrössen führen ebenso zu einem teuren und wenig umweltverträglichen Einsatz von Produktionsmitteln, inklusive Energie. In einem eng besiedelten Raum wie der Schweiz wirkt sich das besonders nachteilig aus.
Gesalzene Rechnung
Wer bezahlt nun eigentlich diese 21 Milliarden? Einerseits der „Staat“ mit den vielen Subventionen. Den grössten Teil aber berappt der Konsument. Aber de facto eigentlich dieselben Subjekte: die Bürger.
Nebst den ziemlich gut messbaren Kosten an Beiträgen und Vergünstigungen für die Landwirtschaft gehen andere Kosten bei der wahren Kostenberechnung oft verloren. Die Importhindernisse für die meisten landwirtschaftlichen Produkte beispielsweise provozieren aufgrund der damit einhergehenden inländischen Preiserhöhungen einen ausufernden Einkaufstourismus im Ausland. Dieser führte nicht nur zu Verlusten an heimischem Agrarumsatz, sondern insgesamt zu einem rund 10-Milliardenverlust an generellem Einzelhandelsumsatz. Wenn das Schnitzel nur die Hälfte kostet im nahen Ausland, wird dieses Schnitzel eben zur Benchmark – und löst generell eine Schoppingwut ennet der Grenze aus. Ein Lehrstück, wie man sich selber schaden kann. Man kauft nebst dem Schnitzel nämlich auch gleich andere Konsumgüter, für welche man die Unbill mit der Fahrt über die Grenze eigentlich gar nicht in Kauf genommen hätte. Eine typische negative Rückkoppelung, welche meistens dann eintritt, wenn das Big Picture verloren geht. Planwirtschaft geht eben oft ins Auge. So wird der von einer breiten Schicht vertretene aktive Protektionismus mit dem derzeitigen Agrar-Regime tatsächlich zum Schuss ins eigene Bein.
Unsere Landwirtschaft konnte bereits zwei wichtige Freihandelsabkommen (USA und Mercosur) bodigen oder einbremsen. Sie scheiterten in der Tat an der Agrarlobby. Die Landwirtschaft produziert also auch Kollateralschäden, welche in den 21 Milliarden noch gar nicht eingerechnet sind.
Schweizer Landwirtschaftsprodukte als Exportschlager?
Nur zu oft wurde die Strategie kolportiert, landwirtschaftliche Spezialitäten zu produzieren, welche auch exportfähig sind. Käse, Milch, geräucherte gastronomische Preziosen, und so weiter. Ja, Skalenerträge sollten her: Wenn wir nur genügend Volumen hinkriegen, könnten wir günstiger produzieren. Also Export.
Ein hehrer Anspruch. Aber warum sollte dies der Staat fördern? Er könnte ebenso eine heimische und exportfähige Automobilproduktion fördern. Es darf nun einmal nicht am Staat sein, solche Aufgaben zu übernehmen. Wenn sich Schweizer Bauern auf einzelne Spezialitätenprodukte konzentrieren, welche sich im Ausland tatsächlich absetzen lassen, ist das erfreulich. Aber der Bürger sollte dafür nicht bezahlen müssen. Wieso auch sollten wir einen Käse subventionieren, der schliesslich in Shanghai verkauft wird?
Die wahren Export-Champions für Nahrungsmittel sind so oder so die Industrien: Nestlé zum Beispiel ist zum weltweit grössten Exporteur von Kaffee aufgestiegen. Aus der Schweiz raus, ohne eigenen Kaffeeanbau – und ohne Subventionen.
Vergessen wir also die Exportförderung von Nahrungsmitteln. Ein kleinflächiges Land mit atomisierten Anbauflächen, nur mittlerem sonnigem Klima und hohen Löhnen kann nun einmal nicht mithalten im Agrar-Weltmarkt. Ausser eben mit ein paar Nischenprodukten.
Die Lösung?
Ein Umbau der helvetischen Landwirtschaft müsste umfassend angegangen werden. Nachfolgend ein 5-Punkte-Programm, welches mit gewissen Übergangsfristen realisiert werden könnte:
- „Autonomie“ mittels eigener Landwirtschaft ist in der Schweiz gar nicht möglich – also müssen wir uns davon verabschieden. Alternativ müssen die Pflichtlager erhöht werden, damit auch der Versorgungsgrad verbessert wird. Pflichtlager können der Bund selber, Importeure oder der Grosshandel halten. Auch die Industrie musste aktuell lernen, mehr Redundanz in der Versorgung zu erzielen. Strengste „Just in time“-Prinzipien sind krisenanfällig – das hat sich gerade aktuell gezeigt. Das gilt auch für die staatliche Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung.
- Die meisten Subventionen müssen massiv reduziert werden. Auch alle Direktzahlungen, Zölle und alle anderen protektionistischen Hilfen sollten massiv abgebaut werden. Der bescheidene BIP-Beitrag von 0.6% würde sich vielleicht noch weiter verringern. Auch würden weitere Bauernhöfe eingehen, die heimische Fleischproduktion würde sich reduzieren. Natürlich würde der Bauernstand leiden – ganz klar. Das wäre zwar bedauerlich, wäre indessen mit gewissen Übergangsfristen zu verantworten. Und wir würden Milliarden sparen.
- Die Qualität der Lebensmittel muss durch Normen auf Grosshandels- und Einzelhandelsstufe sichergestellt werden. Inhaltsstoffe, Produktionsmethoden, etc. können (wie heute schon) vorgeschrieben werden – nur würden diese künftig für alle gelten, nämlich auf der Stufe der Verteilung kurz vor dem Verzehr – und nicht ab der Grenze. Die ausländischen Produkte werden heute nämlich oft genauer beurteilt als die einheimischen oder via zahlreiche „nicht-tarifäre Handelshemmnisse“ benachteiligt.
- Die Schweizer Landwirtschaft soll sich auf biologisch hochwertige Produkte konzentrieren und dafür Bewirtschaftungsbeiträge pro Hektare erhalten. Keine neuen Staatsangestellten sollten geschaffen werden, sondern effiziente kleine Unternehmen. Diese müssten sich vermehrt auf den lokalen Direktvertrieb konzentrieren. Wenn Handelsstufen umgangen werden können, ergeben sich auch andere Margen, und die höheren Produktionskosten fallen weniger ins Gewicht. Regional, klein und fein: innovative Biobauern. Es würde sich lohnen, wenn allenfalls sogar der Bund hier Institutionen unterstützt, welche Marketing und Vertrieb dieser Betriebe mit Nischencharakter professionalisieren. Ein grosser Teil der Bevölkerung ist heute schon bereit, für regionale und ökologisch überzeugende Produkte etwas mehr auszugeben. Gleichzeitig müssen wir uns von den klassischen Bauernbetrieben verabschieden, welche nur teuer, aber wenig ökologisch und den ausländischen Produzenten qualitativ kaum überlegen sind.
- Für die Pflege der Landschaft braucht es ein neues Konzept – das der Landschaftsgärtner. Wie immer auch ein solches Programm ausfallen könnte: Im Vergleich zu heute würde es nur einen Bruchteil der bisherigen Kosten verursachen.
Und was machen wir dann mit dem eingesparten Geld?
Wenn es uns gelingt, mit dem Grossteil der eingesparten Milliarden Steuern zu senken, Schulden abzubauen oder mehr in sinnvolle und zukunftsgerichtete Projekte zu investieren, können wir nur gewinnen. Und wenn sich gleichzeitig die Nahrungsmittel in der Schweiz deutlich verbilligen, sinken unsere Lebenshaltungskosten und unser Preis-/Lohngefüge wird wettbewerbsfähiger. So könnten wir sogar doppelt gewinnen.
Fazit:
Die Pandemiekrise konnten wir nicht wegen unserer tollen Landwirtschaft meistern. Die Versorgung blieb fast immer lückenlos gewährleistet – dank den logistisch hervorragend aufgestellten Detailhändlern, welche sich zum grossen Teil auch im Ausland eindecken. Das Argument der „Autonomie“ oder der „Systemrelevanz“ wird überstrapaziert. Der Staat und die Konsumenten könnten mit einem Umbau der Landwirtschaft immense Summen sparen. Für die Gewährleistung der Lebensmittelversorgung und der Lebensmittel-Qualität gibt es Lösungen, auch für die nötige Pflege der Landschaft.
Unsere kleine offene Volkswirtschaft könnte mit einem klaren Paradigmawechsel nur Vorteile erzielen, denn mit dem Abbau von Zöllen und anderen protektionistischen Winkelzügen stünde unser Land besser da. Vermehrt wären Freihandelsabkommen möglich, und die Effizienz in Beschaffung und Produktion könnte sich erhöhen.
Es gäbe ganz wenige Verlierer – aber viele Gewinner. Wann wohl diese politische Reife einkehren wird?