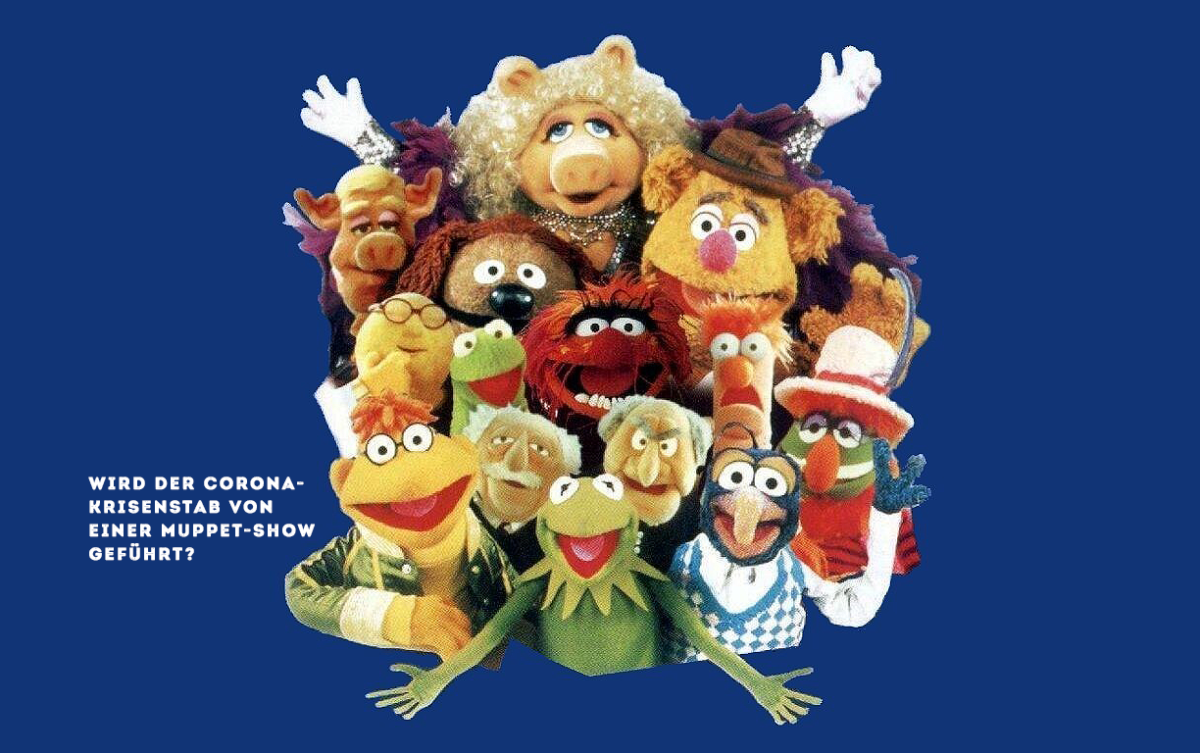Oder was passiert, wenn China amerikanische Firmen klaut?
Schliesslich sei die Globalisierung an der wirtschaftlichen Misere schuld, welche die Pandemie hervorgerufen hat. In der Tat ist es offensichtlich, wie plötzlich unterbrochene Lieferketten zu punktuellen Engpässen führen konnten. Medikamente wurden knapp, medizinische Ausrüstungen fehlten. Auch im Supermarkt fehlten vorübergehend ein paar Artikel. „Das hat man nun von der Globalisierung.“ Die Pandemie wird zu einem Abgesang auf die Globalisierung führen, Industrien werden heimgeholt. Autonomie ist jetzt angesagt. Soweit viele Stimmen. Alles falsch: Es wird das Gegenteil eintreten, die Globalisierung wird weiter zunehmen! Und wer sich ihr entgegenstellt, wird verlieren.
Der nationale Egoismus nimmt zu
Zur offensichtlich gewordenen, grossen internationalen Abhängigkeit kommt hinzu, dass sich einzelne Staaten in der Krise plötzlich ziemlich egoistisch verhalten: Sie klauen einander Masken, horten Medikamente, kaufen sich bei Impfstofffirmen mit exklusiven Belieferungsverträgen ein. Die Grenzen werden ohne Absprache geschlossen, Risikogebiete zum Teil willkürlich definiert und Quarantänen ohne Absprache und Koordination verhängt. Die Stimmen werden lauter, dass die Globalisierung nun vielleicht Geschichte sein könnte. Wirklich…?
Globalisierungsgegner auf dem Holzweg
Schon vorher gab es (zumeist etwas verklärte) Globalisierungsgegner. Oder die Verschwörungstheoretiker, die eine Weltregierung aufziehen sahen – also sollte die Globalisierung raschmöglichst gestoppt werden. Leider lässt sich die fortschreitende Digitalisierung indessen nicht aufhalten, die verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten, die Onlinesysteme, welche den ganzen Globus plötzlich zum persönlichen Supermarkt und Informationszentrum machen. Die fortschreitende Vernetzung lässt sich nun mal nicht per Dekret, Wunsch oder Überzeugung stoppen. Paradoxerweise legt die Corona-Krise die Globalisierung nicht nur offen und macht sie sichtbarer, sondern wird sie auch fördern: Die Abstimmung der einzelnen Staaten aufeinander wird zwangsmässig eher zunehmen, Forschung und Entwicklung von Impfstoffen werden globaler aufgestellt, der Informationsaustausch zwangsmässig ebenso intensiviert. Einzelne egoistisch-nationale Aktivitäten werden das nicht stoppen können.
Das zum Teil kollektive Versagen in der Pandemiebekämpfung und die – vielleicht erst später – einzugestehenden Fehler werden die Globalisierung ebenso eher fördern. Die Pandemiekrise ist nun einmal ein Weltthema.
Globalisierung ist zum Teil technologiegetrieben
Die technologische Entwicklung der einzelnen Branchen und Gesellschaften wird ebenso wenig aufzuhalten sein wie deren globale Verbreitung. Damit wird der Austausch von Information und Wissen beschleunigt und so auch Wertschöpfungs- und Lieferketten noch stärker globalisiert. Auch die Verzahnung der Finanzsysteme wird durch diesen Austausch weltweit gefördert. Diese selbstlaufenden Tendenzen lassen sich genau so wenig aufhalten wie einen Tsunami.
Die Einwegmentalität bröckelt
Zwar steigt das Nachhaltigkeitsdenken (zumindest in einigen reifen Volkswirtschaften), welche gewisse wenig sinnvolle Globalisierungsexzesse berechtigterweise in Frage stellen. Trotz aller Wegwerfmentalität wird sich damit, zumindest in diesen sozialen Umfeldern, längerfristig vermehrt Qualität durchsetzen. Diese wird sich verbessern, je mehr Anbieter auf den Plan kommen. Es muss in der Tat nicht alles made in China sein. Auch made in Vietnam oder made in Malaysia kann weiterhelfen – für die Qualität, für die Auswahl, zur Reduktion der Abhängigkeit. Der Markt wird die Globalisierung damit jedoch nicht behindern, sondern eher fördern.
Wenn China richtigerweise in der Kritik steht betreffend seiner Zivilrechtsordnung sowie seinem globalen Umgang mit den „Intellectual Properties“ und nun handelspolitisch von den USA ausgebremst werden soll, wird das die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt nur anspornen, noch besser zu werden. Wer war übrigens fähig, binnen Wochen eine weltweite Maskenproduktion in Milliardenhöhe hochzufahren? China. Ob die Firma Flawa in der Schweiz wohl inzwischen die Maschinen (aus China übrigens) für die Maskenproduktion angeworfen hat?
Ist die EU nur etwas „Geografisches“?
Der „coronitte“ Digitalisierungsschub hat alles näher gebracht. Die globale Kommunikation wird selbstverständlicher. Damit wird nicht nur der Austausch von Information gefördert, sondern auch der Austausch von Waren und Dienstleistungen. Die Lieferketten vernetzen sich so nur noch mehr.
Doch da funkte einiges dazwischen in der Krise: Der mangelnde Zusammenhalt in der EU zum Beispiel. Dieser war ziemlich offenkundig. Sehr plakativ erscheinen im Moment die gegenseitig und unkoordiniert verhängten Reise- und Quarantänebestimmung, welche zum Beispiel den Schengenraum als inexistent erscheinen lassen. Mit Verwunderung beobachten wir das alles. Ebenso wundern wir uns heute, dass die Infizierten und Toten der EU nie zu einem Total in der EU zusammengezählt wurden – ein durchaus symptomatischer Vorgang. Offenbar gibt es „Europa“ also gar nicht, und bleibt denn dieses Europa letztlich nur etwas Geografisches? Sollte gerade dieses nationalistische Verhalten ein Zeichen der Entflechtung reflektieren und damit den Abgesang auf die Globalisierung einläuten? Nein, das wäre ein Trugschluss. Selbst ein Auseinanderbrechen der EU hätte nichts mit „Entglobalisierung“ zu tun. Denn ein allfälliges Auseinandergehen würde letztendlich den Austausch von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Informationen wenig hemmen. Die damit einhergehenden Egalisierungseffekte zwischen den Staaten würden grösstenteils bleiben, ungeachtet vieler politischer und sozialer Risse – zumal viele technologiegetrieben und damit nicht aufzuhalten sind. Mehr Föderalismus fördert in der Regel auch den Wettbewerb und die Effizienz. Eines der besten Beispiele dafür ist der kantonale Steuerwettbewerb in der Schweiz.
Verlierer: die USA
Wenn sich die USA mit ihrem nicht sehr erfolgreichen Handelskrieg gegen China und einer verstärkten „America first“-Attitüde weiterhin profilieren wollen, so werden sie damit langfristig nur verlieren. Und alle andern ebenso, die sich vergleichbar abzukapseln versuchen.
Ein neues Konfliktzeitalter ist mit dem Fall TikTok angebrochen: Die Zwangsveräusserung der chinesischen Tochtergesellschaft an einen amerikanischen Konzern stellt staatliches Raubrittertum dar. In dieser Grössenordnung fand ein solcher Vorgang zum letzten Mal in Venezuela statt, als Hugo Chavez die Ölindustrie verstaatlichte. Auch dies ist – etwas sarkastisch – eben Globalisierung: Man klaut sich global Firmen zusammen. Dass Blackrock und andere Finanz-Heuschrecken ziemlich unverfroren und global agieren, muss in einer einigermassen freien und marktwirtschaftlichen Welt hingenommen werden. Dass jedoch die grösste Volkswirtschaft der Welt, welche persönliche und unternehmerische Freiheit auf ihr Banner schreibt, ausländisch dominierte Firmen unter dem Vorwand des Datenschutzes annektiert, ist ein starkes Stück. Was wohl die mögliche neue Eignerin Microsoft, dieser etwas behäbig gewordene Bürosoftware-Konzern, mit den Daten der jungen Nutzer machen wird? Nun, Microsoft wird sie nutzen… Dies entspricht letztlich nichts anderem als dem Geschäftsmodell von TikTok: nämlich aufgrund der Nutzerprofile Algorithmen entwerfen, welche anschliessend Nutzerangebote vorschlagen und passende Werbung platzieren. Microsoft würde alle Nutzerdaten also fein säuberlich speichern und verwenden, wo immer es geht – mit dem Einverständnis der Nutzer gar. Diesen ist es so oder so ziemlich egal, was mit ihren Daten passiert. Was der chinesische Staat (nicht nur die Firma TikTok) wohl mit den Daten gemacht hätte, hätte er tatsächlich Zugriff darauf? Wohl dasselbe: nutzen? Aber wie und wofür? Es herrscht doch etwas Erklärungsbedarf.
Was passiert, wenn China amerikanische Firmen klaut?
Man stelle sich vor, die chinesische Regierung erpresst einen amerikanischen Konzern, um dessen chinesische Tochterfirma in Shanghai (welche einen mehrfachen Milliardenwert darstellt) an einen chinesischen Konzern zu verkaufen. Wenn nicht, so binnen fünf Wochen, würde die Firma geschlossen. Donald Trump würde in einem solchen Erpressungsfall wohl ziemlich überstürzt die amerikanische Botschaft in Peking schliessen und einen Flugzeugträger losschicken. Genau dies tut er jedoch selber mit den chinesischen Eigentümern von TikTok.
Die wahre Qualität dieses Firmenklaus von TikTok wurde jedoch erst augenscheinlich, als der amerikanische Präsident eine fette Kommission von Microsoft für diesem inflagranten Deal einforderte, so dieser zustande kommen sollte.
Das „Nachhauseholen“ von Industrien könnte nun vordergründig als Zeichen der globalen Entflechtung interpretiert werden. Die Stigmatisierung von Huawei geht z.B. in dieselbe Richtung. Es handelt sich meistens um Einzelmassnahmen, insbesondere der amerikanischen Administration. Vorgeschoben werden (berechtigte oder unberechtigte) Vorwürfe der Datenspionage; tatsächlich geht es indessen vorab um „America first“ – also um blanken Protektionismus zugunsten der einheimischen Industrie.
Es gibt genügend Anschauungsunterricht, wohin Protektionismus schliesslich führt: letztlich immer zu Ineffizienz, zu technologischem Rückschritt und am Ende zu einer reduzierten Wettbewerbsfähigkeit. Offene Volkswirtschaften waren schon immer erfolgreicher – das lehren uns nicht nur die meisten Ökonomen, sondern das lehrt uns auch die Geschichte. Wenn die USA nun vermehrt auf Protektionismus setzen, werden sie aus diesem Spiel als Verlierer hervorgehen.
Diesen einzelnen „Entglobalisierungs-Erscheinungen“ steht ein Übermass an nicht aufhaltbaren Globalisierungsfortschritten gegenüber. Einzelne nationalistische Tendenzen fallen also nicht sehr ins Gewicht.
Keine Erdbeeren mehr…?
Einzelne Regierungen können die weiteren Globalisierungsschritte nicht aufhalten. Es ist so, wie wenn man einen Markt steuern wollte – das funktioniert selten. Die Marktteilnehmer möchten die Globalisierung nämlich nicht stoppen. Im Gegenteil, sie tragen täglich entweder mit ihrem Konsum oder als Produzent oder Dienstleister dazu bei. Die Globalisierung ist nun einmal an einem „Point of no return“.
Alle national verbrämten Ideen, „die Industrien zurückzuholen“, sind eine Illusion. Davon träumen vielleicht ein paar populistische Politiker, nicht aber Unternehmer. Übrigens, damit wir es nicht vergessen: Erfolgreiche Unternehmen werden fast ausnahmslos von Unternehmern und nicht von Staaten geführt!
Wenn Renault nun fünf Mia Euro vom Staat erhält, um sich fit zu trimmen, wird dies wohl kaum funktionieren. Produktionen und die Teile- und Knowhow-Beschaffung sollen nach Frankreich repatriiert wird. „Rénationalisation“ oder „réindustrialisation“? Bonne chance.
Natürlich kann jedes Individuum zur weltweiten Ökobilanz im positiven Sinne betragen, wenn wir im Supermarkt im Winter keine Erdbeeren aus Südafrika kaufen oder darauf verzichten, bei Alibaba in China ein Paar Turnschuhe zu bestellen. Selbst eine ansehnliche Summe solcher westlichen vernünftigen Einzelentscheide wird die fortschreitende Vernetzung der globalen Lieferketten jedoch nicht stoppen. Wenn Granitfliesen aus China in unserem Hof verlegt werden, ist das wohl wenig sinnvoll. Wenn die Transportkosten energiebedingt längerfristig jedoch steigen, wird sich das Problem vielleicht von selbst lösen – aufhalten können wir diese zum Teil irrwitzigen Beschaffungswege jedoch kaum.
Alle zum Teil gut gemeinten subjektiven vernünftigen Verhaltensmuster und Handlungen oder einzelne verquere politische Nationalisierungsentscheide sind nur ein Tropfen auf den heissen Stein, um die Globalisierung zu verzögern. Globalisierung kann nicht gestoppt werden.
Die Pandemie ist letztlich ein Brandbeschleuniger der Globalisierung
Die Pandemiekrise zeigt, dass man diese Krise nicht national lösen kann. Abschottung wird uns nämlich weder die medizinischen Ausrüstungen, noch Medikamente, noch Impfstoffe oder einen ungehinderten wissenschaftliche Zugang garantieren. Eigentlich hat uns Cocid-19 nicht nur de facto, sondern auch psychologisch mehr Internationalität gebracht: Die ganze Welt war plötzlich in unserem Wohnzimmer zu Gast.
Auch aus Sicht der Firmen wurde die globale Vernetzung gefördert: Lieferengpässe und unterbrochene Lieferketten mussten blitzartig behoben werden. Man lernte – und zwar sehr rasch.
Natürlich lernte man auch, wie ohnmächtig abhängig wir sind von diesen perfekt getakteten Just-in-time-Lieferungen, diesen fein austarierten Netzen aus globalen Anlieferungen.
Die Konsequenzen heute sind klar: mehr Redundanz. Das heisst allerdings, eben nicht nur auf Eigenproduktion abstellen, sondern die Beschaffung diversifizieren. Das bedeutet Ausweichen auf möglichst unabhängige Märkte – auf globaler Basis.
Primär- und Zwischenprodukte, aber auch Dienstleistungen (wie z.B. Software) dürfen eben nicht nur von einem einzigen Ort bezogen werden – an sich eine Binsenwahrheit. Es brauchte wohl diese Pandemie-Krise, um die Klumpenrisiken sichtbar zu machen. Die künftigen multiplen Absicherungen werden etwas Geld kosten, jedoch die internationale Vernetzung nur fördern!
Die singuläre Abhängigkeit von sich selbst wäre nicht sehr intelligent
Abgesehen von einzelnen protektionistischen Spielen à la Trump werden längerfristig die Handelsschranken zwischen den Staaten eher abgebaut werden. Der Druck der Industrie auf die Politik wird steigen, die weltweiten Beschaffungsströme möglichst ungehindert fliessen zu lassen. Güter durchlaufen während ihren Entstehungsprozessen bekanntlich oft mehrmals die Länder, quer durch die Welt. Im Zuge der künftigen diversifizierten Beschaffung wird sich dies noch verstärken. Der Abbau von Handelsschranken – und auf einer globalen Basis wird dies kommen, trotz punktueller Handelstreitigkeiten – wird die Versorgungssicherheit der Industrie nur verbessern. Das gilt übrigens auch für die Landwirtschaft, bzw. die Versorgungssicherheit eines Staates mit Nahrungsmitteln. Gouverner c’est prévoir: Dazu gehört auch die Sicherstellung einer gewissen Autonomie – welche sich mit nationalistischen Manövern gerade nicht erzielen lässt. Die singuläre Abhängigkeit von sich selbst ist nun einmal nicht sehr intelligent, eine breite Aufstellung bringt mehr Sicherheit.
Renationalisierungen und der Abbau der Globalisierung sind einfach zu teuer. Ein paar Politiker möchten diese zwar herbeireden – aber realistisch sind sie nicht. Und wer sollte diese Massnahmen denn, falls tatsächlich in Angriff genommen, bezahlen? Der Staat? Wohl kaum. Das „System“? Der „Markt“? Eine Illusion.
Die Globalisierung wird also fortschreiten. Das können auch ein paar Handelskriege nicht bremsen, denn Handel ist nicht gleich Globalisierung. Die Globalisierung hat uns – trotz ein paar negativen Nebeneffekten – Wohlstand gebracht. Wer sich der Globalisierung in den Weg stellt, kann nur verlieren.